Redaktionelle Vorbemerkung: Bericht über ein Kunst-am-Bau-Projekt in einem Körperbehindertenzentrum. Die Darstellung hat in zweifacher Hinsicht etwas mit Raum zu tun. Einmal im wörtlich konkreten Sinne: Ausgestalten, Schmücken, Gebrauchsfähigmachen von architektonischen Räumen. Zum anderen geht es um Raumschaffen im erweiterten Wortsinn, um die Ausdehnung des eingeschränkten Bewegungs-, Wahrnehmungs- und Erlebnisraumes körperbehinderter Kinder.
Seit zwei Jahren arbeite ich in einem Körperbehindertenzentrum in Oldenburg, um dort, nach einem gewonnenen Kunst-am-Bau-Wettbewerb, eine Konzeption zu verwirklichen, die den Bedürfnissen, Mangelerfahrungen und Gewohnheiten der hier lebenden Kinder entgegenkommt. Der Erfahrungsbericht, wie ich mit Achim, einem gelähmten Jungen, ein Bild malte, soll diese Konzeption beispielhaft verdeutlichen.
Kunst-am-Bau: nicht nur ein Mittel der Künstlerförderung, nicht ein nachträglicher Zusatz, um Mängel der Architektur zu kaschieren, nicht nur eine Möglichkeit Prestigebedürfnisse von Bauherren zu befriedigen. Es besteht bei diesem Projekt die Chance, Kunst für die und mit denen zu machen, die in diesem Gebäude leben und arbeiten.
Schon die Ausschreibung des Wettbewerbs wich vom Üblichen ab, weil sie zu einem Zeitpunkt stattfand, als noch nicht alle Entscheidungen gefallen waren (also vor Baubeginn), so daß eine-Zusammenarbeit mit dem Architekten noch möglich war und ist. Die Auslober machten sich auch unübliche Gedanken über die mögliche Funktion von Kunst in einem Behindertenzentrum: ,, Integration von Kunst im Baugefüge,… Aktivitäten, Kommunikation förderndes Element, -sinnlich wahrnehmbare Erlebnisbereiche herstellen, … Erziehungs- und Verhaltenshilfen geben.“
Die Aufgabenstellung
Ein Körperbehindertenzentrum am Stadtrand von Oldenburg soll einen Erweiterungsbau erhalten. Es besteht ein Altbau und ein schon fertiggestellter Neubauteil. Schule und Tagesstätte unter einem Dach, aber zwei verschiedene Träger: Kommune und Diakonisches Werk. Circa 100 körperbehinderte Kinder vom Vorschul- bis zum Schulentlassungsalter verbringen hier am „Borchersweg“ den größten Teil ihres Alltags: von 7.30-16.00 Uhr. Sie werden in kleinen Gruppen betreut und erfahren zusätzlich die unterschiedlichste Einzelförderung, von der Reittherapie bis zur speziellen Sprachförderung. 60 % von ihnen sind Rollstuhlfahrer, viele sind mehrfachbehindert.
Erste Eindrücke
Mein erster Besuch in dieser Einrichtung bringt schon die entscheidenden Eindrücke, die das Arbeitskonzept später bestimmen.
Körperbehinderte Kinder haben dieselben Bedürfnisse wie andere Kinder auch: Wärme, Zuneigung, Anerkannt-werden, Abenteuerlust, Entdeckerfreude. Sie müssen aber Einschränkungen ihres Wahrnehmungs-, Bewegungs- und Erlebnisbereiches hinnehmen. Auf Schritt und Tritt spüren wir das hohe Maß der Abhängigkeit von Technik und menschlicher Betreuung. Technische Apparaturen wie Rollstühle, Gehwerkzeuge jeglicher Art, Korsette, Beinschienen, Sitzschalen: Wenn nachmittags die Abholtaxen kommen, wird das ganze Arsenal von Hilfswerkzeugen sichtbar, und wieviel menschliche Handgriffe nötig sind, um sich ihrer zu bedienen. Eigeninitiative und Selbständigkeit der Kinder sind dadurch notgedrungen eingeschränkt. Die gelegentlich ängstlich gesteigerte Fürsorge der Eltern trägt noch zusätzlich dazu bei. Von vielen Alltagserfahrungen sind diese Kinder ausgeschlossen, die zum Begreifen der Welt gehören und die das Ausdrucksverhalten bestimmen.
Behinderte Kinder haben ein anderes Verhältnis zu Zeit und Raum. Ich habe beobachtet, wie ein Rollstuhlfahrer in minutenlangem Zeitaufwand eine Tür schloß, ständig mit dem Rollstuhl rangierend. Verrichtungen, die gesunde Kinder beiläufig und mühelos erledigen, sind für ihre behinderten Altersgenossen mit erheblichem Aufwand an Zeit, Mühe und Konzentration verbunden.
Und trotzdem, schon zu Beginn und erst recht im Laufe unserer Arbeit habe ich immer wieder erfahren, daß Mangel und Einschränkung auf der einen Seite Reichtum und Fülle auf anderen Gebieten entstehen läßt. Wahrnehmung und Ausdrucksverhalten und die Art, menschliche Kontakte anzuknüpfen, sind oft anders als bei nicht behinderten Kindern, aber nicht minder intensiv, wie wir immer wieder zu spüren bekamen.
Die Aufgabe, die ich mir selber stellte, war da anzuknüpfen, wo die Kinder sensibler, wahrnehmungsfähiger und stärker sind. Ich wollte ihnen einen Rahmen zur Verfügung stellen, innerhalb dessen sie sich selber nach ihren Möglichkeiten und Bedürfnissen ausdrücken können, wohl wissend, daß man Ausdrucksmöglichkeiten erst herauslocken und manche latente Bedürfnisse erst wecken muß. Das Vertrauen in ihre eigene Ausdrucksfähigkeit will ich stärken und damit ihr Selbstvertrauen und ihre Lebenstüchtigkeit. Darüber hinaus sollen in ihrem ordentlichen, rechtwinkligen, hygienischen Gebäude Objekte entstehen, die ihnen wenigstens ansatzweise Erlebnisbereiche erschließen helfen, die andere Kinder in Pfützen, Schlamm, Büschen, Wiesen und Bäumen finden: Klangobjekte, Tastobjekte, Objekte, die wandlungsfähig sind.
Nicht vorgefertigte Kunstobjekte werden wir (meine Mitarbeiter und ich) hinstellen und anbringen, sondern die Konzeption weitgehend mit Kindern und Betreuern entwickeln und die Objekt zu-. sammen erstellen oder zumindest ihre Herstellung miterleben lassen. Wir hoffen, daß es möglich ist, aufgrund konkreter Beobachtung der Gegebenheiten Prozesse einzuleiten, die später auch ohne unsere Mitwirkung fortsetzbar sind.
Meine Voraussetzungen:
Mit Kunsttherapie hatte ich bislang nichts zutun. Allenfalls an mir selber habe ich erfahren, daß das Kunstmachen auch. therapeutische Wirkungen für mich hat. Kunstpädagogik ist mein Beruf im Rahmen einer Fachhochschule für Sozialpädagogik. In zwei Projekten habe ich Kunst-am-Bau-Erfahrungen gesammelt, als ich zusammen mit einer Arbeitsgruppe zwei Berliner Mittelstufenzentren mit ausgestaltete. Lernzeiten, teures Lehrgeld haben wir bezahlen müssen. Auch in diesen Projekten hatten wir versucht, die „Betroffenen“ soweit wie irgend möglich in die Konzeption mit einzubeziehen. Vor allem ging unserer Arbeit eine Phase der „Umfeldanalyse“ voraus, in der wir die Bedürfnisse, Lebensbedingungen und Gewohnheiten der Schüler zu ermitteln suchten, um konkret auf sie einzugehen. Vor allem folgende Lehren habe ich aus dieser Arbeit gezogen:
- Gedankengänge und Konzeptionen mögen in sich schlüssig und gut sein, sie können aber nur zu befriedigenden Ergebnissen führen, wenn sie auf Aufnahmebereitschaft und -vermögen derer treffen, für die sie entwickelt werden. Dafür Voraussetzungen zu schaffen ist Bestandteil der Arbeit.
- In der Arbeit für andere muß ich mich selbst wiederfinden können, meinen Ansprüchen ebenso gerecht werden, wie den Ansprüchen derer, mit denen ich arbeite.
Für uns Künstler muß auf die Phase der Wahrnehmung und Einfühlung immer wieder eine Phase des Zurückziehens folgen. Erst aus der Distanz lassen sich die gewonnenen Eindrücke und Erfahrungen verarbeiten und in konkrete Pläne umsetzen.
- Für eine Konzeption der beschriebenen Arbeit ist eine Hauptvoraussetzung Flexibilität und die Fähigkeit zum spontanen Eingehen auf sich wandelnde Bedingungen und Einsichten. Bei größeren Arbeitsgruppen besteht die Gefahr des Reibungsverlustes. Die speziellen Probleme der Zusammenarbeit haben die Tendenz, die Sachprobleme zu überwuchern, habe ich erfahren.
(Es ist ein Glücksfall, wenn schon zwischen zwei Mitarbeitern ein solches Maß an Übereinstimmung und Gleichklang im Wahrnehmen, Erleben und Verarbeiten besteht, daß ein spontanes, synchrones Reagieren möglich ist, oder daß zumindest der eine die Reaktionsweise des anderen billigt. Ich habe auch dies erfahren in der noch zu beschreibenden Endphase der Arbeit mit Achim.)
Zur Arbeitsweise
- Voruntersuchung
Ich gehe davon aus, daß ich nicht weiß, was die Kinder brauchen, daß ich aber Methoden entwickeln muß, um etwas über sie herauszubekommen, das heißt unter anderem Hilfestellung geben, damit sie sich äußern. Eine Umfeldanalyse sollte (wie in Berlin) der Arbeit vorausgehen, besser Umfelduntersuchung. Der Begriff Analyse deutet auf ein vorgegebenes wissenschaftliches Instrumentarium, mit der man der Wirklichkeit zerlegend, zergliedernd zuleiberücken kann. Mir kam es vor allem auf Anschaulichkeit, sinnliche Erfahrbarkeit an. Wenn die Arbeit zu anschaulichen Ergebnissen führen sollte, dann sollte auch die Methode der Voruntersuchung selbst schon anschaulich sein, ausgehend von unseren (meiner und meiner Mitarbeiter) subjektiven sinnlichen Wahrnehmungen.
Die Methode ist eine künstlerische: sammeln, subjektiv verarbeiten und neu organisieren von sinnlichen Eindrücken.
Unser internes Motto war:
genau hinsehen,
genau hinhören,
zu Wort, zum Ausdruck kommen lassen (dafür u. U. Artikulationshilfen geben).
Offen und unvoreingenommen zu sein, hatten wir uns vorgenommen. Wir wollten möglichst wenig Vorstellungen mitbringen, die uns ja auch die Wirklichkeit verstellen können, sondern uns erst einmal beeindrucken lassen. Unnötig zu sagen, daß wir natürlich Vorprägungen, Vorerfahrungen unterschiedlichster Art mitbrachten. Das Offensein für Eindrücke ist durchaus eine physische Anstrengung, etwas, das Kraft kostet, haben wir erfahren.
Eine Einstellung, eine Haltung kennzeichnet den Beginn unserer Arbeit, weniger ein ausformuliertes gedankliches Konzept. Nötig war vor allem: physische Anwesenheit, Zeitnehmen für das Sammeln von Eindrücken. Eine wichtige Rolle räumten wir dem Zufall ein: aufgreifen, was auf uns zukommt.
Das erste, was uns zufiel, war eine Rolle bei einer Mitarbeiterfortbildungsveranstaltung: etwas von unserem Vorhaben zu erzählen. Die Initiative ging von der Einrichtung aus.
Eine neue Perspektive: Einen Vormittag lang bewegte ich mich nur im Rollstuhl fort. Nicht nur die geringere Sehhöhe, sondern auch die Art, sich auf Gegenstände und Personen zuzubewegen, beeinflußt die Wahrnehmung.
Gesprächskontakte ergaben sich mühelos und beiläufig. Ein Kind, dessen Sprache ich kaum verstand, das sich aber mit Gesten mir gut verständlich machen konnte, führte mich mit dem Rollstuhl durch die Einrichtung, zeigte mir seinen Bereich. Viele Beispiele ließen sich noch. anführen.
Eine Folge unserer Anwesenheit zeigte sich bald: wir, die wir uns vor allem wahrnehmend in der Einrichtung aufhielten, beeinflußten auch die Wahrnehmung derer, die mit uns umgingen. Einige Mitarbeiter fingen an, ihre Umgebung mit unseren Augen, unter unserer Problemstellung zu sehen. Ein Erzieher z. B. hängte für Rollstuhlfahrer zu hoch angebrachte Bilder niedriger.
- Feedback
Um die für uns so wichtige Bereitschaft der Lehrer, Betreuer und Kinder zur Mitarbeit zu gewinnen, war es nötig, unsere gewonnenen Eindrücke und Erfahrungen zurückzugeben. Welche Mittel konnten wir dafür gebrauchen? Zunächst einmal hatten wir die Schwierigkeit, unsere Wahrnehmungen für uns zu speichern und zu ordnen, um sie wieder in der Einrichtung öffentlich und verfügbar zu machen. Wir wählten die Mittel Fotografie und Tagebuchnotizen.
Zuhause in Düsseldorf (die räumliche und zeitliche Distanz war wichtig) werteten wir unsere Fotos und Tagebucheintragungen so aus, daß wir sie bei unserem nächsten Besuch in den Fluren als Wandzeitung aushängen konnten. Verständliche, anschauliche Sprache und übersichtliche Gliederung sollten der Lese- und Sehlust entgegenkommen. Die schriftlichen Notizen waren mehr für Mitarbeiter und ältere Schüler bestimmt. Eine Bemerkung zur Notwendigkeit von Distanz: Um den nötigen freien Bewegungsraum für unsere Arbeit zu erhalten, durften wir nicht zu sehr in die alltägliche Arbeit integriert werden. Anregen und Einflußnehmen ist leichter, wenn man von außen kommt.
Neben Fotodokumentationen und Tagebuchnotizen half eine Wandzeitung für spontane Niederschrift von Ideen und Vorstellungen, den Kontakt aufrechtzuerhalten, wenn wir nicht anwesend waren. Eine graduierte Sozialpädagogin, die Anerkennungsjahr und Abschlußarbeit mit der Mitarbeit in diesem Projekt verband, war häufiger in der Einrichtung, beteiligte sich am Unterricht, an vielen Veranstaltungen der Tagesstätte mit dem Ziel, möglichst viel über Bedürfnisse und Gewohnheiten der Kinder zu erfahren, was für die konkrete Entwurfsarbeit wichtig sein konnte.
Die Kritzeiwand
Beispielhaft für unseren Versuch, die Erkundungsphase nahtlos in die Entwurfs- und Ausführungsphase übergehen zu lassen, war die Kritzelwand. Ich hatte den Mitarbeitern von unserer Berlin-Arbeit berichtet, Dias gezeigt und vor allem eine Erfahrung näher ausgeführt: wie ein Projektmitarbeiter im Kreuzberger Mittelstufenzentrum eine Betonwand weiß anstrich, um sie für die Schüler zur Bearbeitung freizugeben. Es war spannend und überraschend, ‚was sich da innerhalb kürzester Zeit entwickelte: von zaghaften, angeleiteten Versuchen bis zu explosionsartigen Schmierereien, Sprüchen, Obszönitäten, Politparolen. De Wand wurde zum Politikum: bestimmte Sprüche mußten gelöscht werden, verfügte die Schulleitung. Dies nur knapp zur Entstehungsgeschichte. Wir konnten viele Schlüsse aus dieser Erfahrung ziehen, die Wand war sowohl analytisches Instrument als auch gestaltetes Objekt. Sie erwies sich für unser Erkundungsbedürfnis wirksamer als eine soziologisch fundierte Matrix, mit deren Hilfe wir Daten erheben wollten.
Ein Beispiel für eine sinnlich anschauliche Erkundungsmethode: Eine Mitarbeiterin des Oldenburger Behindertenzentrums schlug vor —was ich ursprünglich gar nicht beabsichtigt hatte – so etwas doch auch hier zu versuchen. Wir spannten also einen 10 m langen Packpapierstreifen auf eine kahle Flurwand. Und „taten darüber hinaus nichts. Mit den Betreuern verabredeten wir, geduldig auf das zu warten, was kommt. Es kam lange nichts. Wir spürten, wie scheu, ordentlich und vorsichtig die Kinder sind. Das Haus trägt keinerlei mutwillige Spuren, heimlich gekritzelt oder gekerbt, wie man das aus Schulen kennt (eine mutmaßliche Folge der Überbetreuung und Abhängigkeit der behinderten Kinder). Dann kommen die ersten Äußerungen auf der Wand. Erwachsenenhandschrift. Mitarbeiter wurden offensichtlich ungeduldig und fingen an. Die Kinder brauchten Ermutigung, Aufforderung. Allmählich kommen die ersten Kinderspuren, schöne, spontane, großzügige Zeichnungen. Nun war der Bann gebrochen, die Wand füllte sich. Ein Kind wagte sich über den Packpapierstreifen hinaus und kritzelte auf der Wand weiter. Eine wichtige Grenze war damit überschritten.
Wir dokumentierten fotografisch die verschiedenen Stadien, kommentierten sie mit unseren Beobachtungen und hängten diese Fotodokumente der Kritzelwand gegenüber auf. Ohne auf die Kritzelei Einfluß zu nehmen, bekundeten wir damit Ernstnehmen des Entstandenen, wovon wiederum Ermutigung und Anregung zum Weitermachen ausging.
Aus der Kritzelwand sollte ein Dialoginstrument werden. Eines Tages installierten wir anstelle der provisorischen Packpapierwand eine ebenso große aus Spanplatten, beklebten sie mit Bildteilen aus der alten Papierwand, malten dazu, löschten Teile, montierten flache Gegenstände. Erstmals kam Farbe dazu. Kurz, mit Relikten der alten Wand klebten, malten wir ein neues Bild mit vielen offenen Zonen und gaben sie wieder zum Weiterarbeiten frei. Zwiesprache zwischen Künstlern und Kindern der Einrichtung. Zwischendurch kargere Zeiten, wo wenig passiert. Wir müssen immer wieder Impulse geben. Es ist wie mit einem schwarzen Brett, das seinen Informationscharakter verliert, wenn es nicht sorgfältig gepflegt wird. Irgendwann werden wir vielleicht die Wand als fertig betrachten und zumindest teilweise konservieren. Ein offen angelegtes Experiment mit ungewissem Ausgang, für uns eine reiche Quelle von Erfahrungen und Einsichten.
Anstatt nun alle Erfahrungen zu notieren und die aus ihnen resultierenden Entwurfsideen, will ich lieber die Erfahrungen des ersten abgeschlossenen Teilprojekts schildern. Es zeigt am anschaulichsten, wie die Grundkonzeption des Dialogs mit Kindern und Mitarbeitern zu einer Arbeit führte, deren Ergebnis wir nicht hätten vorplanen können und wie sie künstlerische, pädagogische und therapeutische Elemente vereint.
Die Geschichte der gemeinsamen Arbeit mit Achim
Achim ist ein junger Mann von knapp 20 Jahren, fast völlig gelähmt, Muskelschwund. Er kann sich nur im Elektrorollstuhl fortbewegen. Während der Arbeit an der Wandzeitung vor 2 Jahren kam er immer wieder mit seinem Rollstuhl an unserem Arbeitsplatz vorbei. Sein waches, intelligentes Gesicht fiel mir auf, aber auch seine spürbare Scheu und Zurückhaltung. Spontan fordere ich ihn auf, auch einen der großen Buchstaben auszumalen, wie es gerade andere Kinder taten, wohl wissend, daß er dies nicht kann. Ich würde es für ihn tun, sage ich, genau nach seinen Angaben. Nach kurzem Zögern, Erröten, willigt er ein, beauftragt mich, ein großes E ganz blau zu malen. Ich füge seinen Namen ein, wie es die anderen Kinder auch taten. Diese kleine Geschichte hat mich lange beschäftigt: ob es möglich ist, einem Behinderten seinen gesunden Arm zu leihen (und nicht nur diesen), um mit ihm gemeinsam ein Bild zu malen.
Viel Vorarbeit müßte da geschehen. Im Laufe der folgenden Arbeit spreche ich Achim immer wieder an. Wir wollen ein Bild zusammen malen. Er ist einverstanden. Unser Kontakt ist immer noch scheu und sparsam. Aber immerhin, es kommen schon mal Unterhaltungen zustande, er erzählt mir auf Fragen, was er gerne mag, was ihn bedrückt. Von seinen Gruppenbetreuern höre ich, daß das schon viel heißt. Er ist auch in der Gruppe scheu, wagt kaum jemanden um Hilfe zu bitten, die er so dringend braucht. Als er mich einmal bittet, seine Hand wieder auf den Schaltknopf des Elektrorollstuhls zu legen, nehme ich dies als ein Zeichen eines wachsenden Vertrauens. Viel Zeit vergeht dann, durch Bauverzögerung dehnt sich auch unsere Arbeit in die Länge. Im Frühjahr dieses Jahres, 11/2 Jahre nach der 1. Episode, vereinbaren wir, konkret mit der Arbeit zu beginnen.
Bei mir tauchen Zweifel auf: wie wird das im Behindertenzentrum aufgenommen, einen Jungen so herauszuheben, wie wirkt sich das im Zusammenleben und auf den Jungen selber aus? Gespräche mit der Leiterin der Tagesstätte und der Gruppenleiterin ermutigen mich.
Ich weiß inzwischen von Achim, daß er trotz seiner Behinderung gern Autos zeichnet. Es soll ein Autobild werden. Ein Briefwechsel geht voran. Achim schickt mir Zeichnungen, schreibt mir, daß er Rennautos liebt. Ich erzähle von meiner
Arbeit, mache flüchtige Entwurfsskizzen. Die Zeit drängt, Achim wird im Sommer aus der Schule und Tagesstätte entlassen. Ich fahre zum ersten Gesprächstermin nach Oldenburg. Viel Zeit zum Unterhalten wollen wir uns nehmen. Da sitzen
wir uns nun etwas befangen gegenüber. Wie anfangen? Wir müssen uns erst genauer kennenlernen, bevor wir zusammen arbeiten können. Achim zum Reden zu bringen ist schwierig, er antwortet nur präzise und knapp auf gestellte Fragen. Wir beschließen, uns gegenseitig unseren typischen Alltagsablauf zu schildern; ich fange an, um die Befangenheit redend zu überwinden. Achim folgt mit der knappen Beschreibung seines Tagesablaufs. Ich merke erstmals, wie wichtig seine Mutter für ihn ist, die ihm intensive Gesprächspartnerin ist, die die Arbeit für ihn und mit ihm als ihre akzeptierte Aufgabe angenommen hat. Unser Gespräch hat lange Pausen; Wir kommen darauf, als hinter uns die Tür öfter aufgeht, wie anders seine Wahrnehmungsart ist als die meine, die ich den Kopf schnell drehen kann.
Seine Wahrnehmung ist anders, aber intensiver, scheint mir, eine andere Koordination von Hören – Sehen – Bewegen. Wir beschließen den ersten Termin mit Wahrnehmungsspielen: Beschreiben, wie die Flure aussehen; Augen schließen, wie das Fenster vor uns aussieht. Achim ist mir überlegen.
Einer spontanen Eingebung folgend, frage ich Achim, ob ich mit ihm nach Hause kommen könne. Nach langem Zögern Zustimmung, als ich vorschlage, eine Stunde später zu kommen als er. Das war wichtig, begreife ich später. Denn diese Stunde brauchen er und seine Mutter für hygienische Verrichtungen. Zuhause bei Achim kommen die entscheidenden Erkenntnisse: Achim liebt nicht etwa Autos, wie alle Jungen, er ist ein ausgesprochener Spezialist für Formel-I-Rennwagen. Ich bekomme Stapel von verblüffend schönen Zeichnungen zu sehen. Ich kann sie erst später richtig würdigen, als ich Zeuge des Entstehungsprozesses werde. Da er seine Hände kaum bewegen kann, ist eine minutiöse Koordinationsarbeit beider Hände nötig: mit der linken das Blatt Papier schiebend, zeichnet er mit der rechten Hand mit geduldigen Schraffuren Autoansichten in komplizierter Perspektive. Achim kann nicht direkt auf’s Blatt schauen, durch eine Prismenbrille wird die Blickrichtung um 90 Grad gebrochen. Neben dem Zeichnen beschreibt Achim viele Seiten mit Rennergebnissen, Ranglisten der Formel-l-Rennfahrer, nachempfundenen Rennberichten in erstaunlich ordentlicher Erwachsenenhandschrift.
Am nächsten Morgen bekomme ich eine Lehrstunde. Achim erklärt mir anhand vieler Bücher, was ich über Rennwagen wissen muß, bevor wir zusammenarbeiten können. So gesprächig hatte ich ihn noch nicht erlebt. Der Boden für weitergehende Fragen war bereitet. Wie er denn leben möchte, wenn er könnte, wie er wollte, frage ich ihn. Und dann kommen – ich kann’s kaum fassen – von diesem sanften, zurückhaltenden jungen Mann aggressive Phantasien: Durch die Gegend rasen möchte er; weit vorn sein; Erster sein; Ehrgeiz; durch wilde Dreher auffallen; bißchen riskant, bißchen Leute ärgern (,‚würde ich wohl bringen‘); alle von der Bahn boxen, abdrängen, weiterfahren; wenn was kaputt ist, sich nicht drum kümmern; Aufholjagden, nach Reifenwechsel wieder ganz nach vorn kommen; nicht nur Rennfahrer sein, auch Mechaniker, Konstrukteur, Held, Fanatiker; als Rennfahrer fällt man mehr auf; bei anderen Menschen Achtung, Verblüffung auslösen, auch unter den Kollegen; da kommt ein Neuer und mischt schon ganz vorne mit; PHÖNIX AUS DER ASCHE!
Soweit meine wörtliche Mitschrift. Wir haben viel gelacht zusammen an diesem Tag. Achim war entspannt und lebendig wie nie zuvor. Er hatte eine sehr sprechende Mimik. Sein Gesichtsausdruck leistet all das, was gesunde Menschen auch mit Gestik und Körperhaltung ausdrücken: Bewegung der Augen, Lachen, Zähne zeigen, Erröten.
Schon vorher waren wir darauf gekommen, daß es viele Analogien zwischen Formel-l-Rennfahrern und Achims Situation gibt: kaum bewegungsfähig, in engen Schalensitzen angeschnallt; „ein Rennfahrer braucht das Steuer nur 2 cm zu-bewegen und schon ist er um die Kurve“; eingeengtes Gesichtsfeld; mit wenig körperlicher Kraft über Motorkraft verfügen. Auch Eigenschaften hat Achim entwickelt, die Rennfahrer haben müssen: Ehrgeiz, Ausdauer, Zähigkeit, Konzentration, Disziplin, Leistungswillen, sich selber Ziele setzen. Mit Zähigkeit, Ausdauer und Konzentration zeichnet er seine mühsamen Autobilder. Eine besondere Disziplin-Leistung, für die er jahrelang trainiert hat: morgens, bevor er in die Schule/Tagesstätte fährt, hilft ihm seine Mutter auf die Toilette, dann hält er aus, bis er am Spätnachmittag wieder zu Hau-
se ist. „Wie ein Computer“. Er achtet sorgfältig darauf, wieviel er trinkt tagsüber. Für ihn bedeutet diese Leistung ein Stück Unabhängigkeit von der Hilfe anderer.
Ich frage Achim, wie er, der so auf andere Menschen angewiesen ist, denn seinerseits Menschen eine Freude machen kann: „Wenn ich zeige, daß ich mit mir selbst gut zurechtkomme, löse ich Achtung und Verblüffung aus.“ Eine Aussage, die man mit gutem Recht für Nichtbehinderte verallgemeinern kann, nur Achim hat es viel schwerer innerhalb seiner Grenzen mit sich zurechtzukommen. Die Beschränkung zwingt ihn zu ganz besonderen Leistungen.. Er resigniert nicht, ist zäh, ehrgeizig. Aber wer honoriert diese Art Leistung, wer nimmt sie überhaupt zur Kenntnis?
Seine Leistungen sind mitteilenswert, überlege ich mir. Zwar kann ich ihm nicht zu einem Rennsieg verhelfen, aber ein Zeitungsartikel über ihn könnte ihn einmal „ganz vorn“ zeigen. Eine Oldenburger Journalistin, die meine Arbeit freundlich interessiert verfolgt, greift die Idee auf: ein langer Artikel über Achim mit Abbildungen erscheint in der Oldenburger Zeitung (Nord-West-Zeitung): „Achim und der große Traum vom Rennfahrer“.
Vorher wieder Bedenken meinerseits: was bedeutet dies für Achim, wie wird er damit fertig, im Mittelpunkt zu stehen, wie nehmen es die Vertreter der Einrichtung, die Mitschüler auf? Wiederum bestärken mich die Leiterin und Achims Gruppenbetreuerin in meinem Vorhaben. Eines unter wiederkehrenden Beispielen, das zeigt, wie sehr ich in meiner Arbeit auf die Einvernehmlichkeit mit den Betreuern in der Einrichtung angewiesen bin. Schon wegen des Vorbildcharakters, die Achims Leistungen und seine Haltung für ähnlich Behinderte haben, halten beide eine Hervorhebung seiner Person für gerechtfertigt. Als ich auch seine Mutter vorher fragen will, wird mir deutlich, daß ich einen typischen Fehler mache: Achim ist volljährig, erwachsen. Er macht es mir klar. Wie oft werden Behinderte wie Kinder behandelt. Achim fühlt sich manchmal unterfordert. Sein Kopf kann viel leisten. Er muß sich seine Leistungsziele oft selber stecken, und tut es, wenn zu wenig Anforderungen an ihn gestellt werden.
Achim ist eine starke Persönlichkeit. Die Entwurfsskizze für das Bild, das wir zusammen machen wollen, liefert er: Eine düstere Landschaft öffnet sich wie ein Fenster, dahinter eine Landschaft in strahlenden Farben. Aus der Öffnung rast ein roter Ferrari-Rennwagen frontal auf den Betrachter zu. So soll das Bild werden. Achim ist beratend bei der Arbeit dabei, billigt eine veränderte Farbgebung (das Bild muß sich von der Klinkerwand abheben), gibt fachmännische Hinweise, wie der Ferrari auszusehen hat. Wir arbeiten ihn nach seiner winzigen Zeitungsvorlage aus, übertragen nicht sein skizziertes Auto. Der Wagen muß möglichst echt“.sein.
Wir arbeiten „vor Ort“, öffentlich, in dem Flur, wo das Bild auch später angebracht wird. Rollstuhlfahrer fahren Slalom um unsere Farbtöpfe und Arbeitsutensilien. Ständig sind Zuschauer um uns herum. Wir stören auch, lassen uns stören. Immer wieder Fragen, Gespräche. Erzieher machen uns mal Tee, sprechen uns aufmunternd an. Ein besonders freundlicher Kontakt entsteht zu den Putzfrauen. Der Hausmeister hilft an verschiedenen Stellen.
Viel mehr, als wir es vorher ahnten, werden wir wirklich zum ausführenden Organ, zum Werkzeug. Mir und meiner Künstler-Mitarbeiterin bleiben die Lösung technisch-organisatorischer und künstlerisch-handwerklicher Probleme: z. B. die angemessene Umsetzung einer Buntstiftzeichnung in Großflächenmalerel: aus einer DIN-A-4-Skizze wird ein 2,50 x 5 m-Bild, von Fußboden bis zur Decke, auf beiden Seiten flankiert von Reproduktionen seiner Autozeichnungen, von Achims Handschrift-Texten, Fotos von Achim, seinem Rollstuhl, technischen Details, Reproduktionen von Rennwagen, Rennfahrer-Fotos. Gerade bis zu seiner Schulentlassung wird das Bild fertig, bis auf Detailausführung, die wir nach den Ferien nachholten.
Wirkungen und Einsichten
Achim verkraftet seinen Erfolg (Zeitungsartikel und Bild betreffend) mit souveräner Gelassenheit. Er schreibt mir in einem Brief: „Es hat mir auch gefallen im Mittelpunkt zu stehen, was sonst nicht der Fall ist… Die Betreuer hat es gefreut, daß Sie sich so intensiv mit mir befaßt haben… Meine Eltern haben sich darüber gefreut, daß ich noch vorm Schulabgang an der Wand verewigt wurde… Meinen Eltern hat der Zeitungsartikel sehr gefallen… Durch ihre Mitarbeit bekam ich Anregung, andere Zeichnungsutensilien zu verwenden, wie Ölfarbe. Bei den Autozeichnungen versuche ich möglichst Landschaften hineinzubringen..
Zu Wort kommen lassen, beim Ausdrücken helfen, war unsere Grundeinstellung. Das Teilprojekt: Bild-mit-Achimmalen, mag exemplarisch verdeutlichen, was mit dieser Einstellung entstehen kann. Die Aspekte, mit denen ich bei einer solchen Kunst-am-Bau-Konzeption zutun habe, sind vielfältig: künstlerische, organisatorische, technische, psychologische, therapeutische Gesichtspunkte müssen integriert und zu einem Ganzen werden. Ein Balance-Akt.
Mir wurde am Ende dieses Arbeitsabschnittes klar, daß vor allem meine künstlerischen Voraussetzungen mir bei dieser Arbeit genutzt haben:
Der Arbeitsprozeß, wenn ich eine Grafik produziere, eine Serie von Zeichnungen herstelle, weist viele Parallelen zu der Arbeit mit Achim auf: Einen beliebigen Einstieg wählen, den Zufall nutzen (es ist nicht zufällig, was mir zufällt), aber dann zäh und systematisch daran weiterarbeiten, nicht zu schnell werten,.,sondern entstehen lassen, offen sein für sich ändernde Bedingungen, nicht zu starr an vorgefaßten Vorstellungen festhalten, Sinn und Augenmaß für die adäquaten Umsetzungsmittel (Werkzeug, Materialien) Umfeldbedingungen einschätzen, nutzen.
Im übrigen hat meine Einschätzung von den Möglichkeiten des „Förderns“ einen Wandel erfahren. Nicht „Förderungskonzepte“ vorerstellen und dann anwenden wie Rezepte; ich verstehe fördern viel mehr in dem ursprünglichen Sinn von zu-Tage-Fördern (wie im Bergbau), verborgene Schätze heben, die vorhanden sind.
Heinrich von Kleist schreibt in seinem „Allerneusten Erziehungsplan“ in Bezug auf die Erziehung von Kindern im allgemeinen: „Aber das Kind ist kein Wachs, das sich in eines Menschen Händen zu einer beliebigen Gestalt kneten läßt: es lebt, es ist frei, es trägt ein unabhängiges und eigentümliches Vermögen der Entwicklung und das Muster aller innerlichen Gestaltung in sich.“
Achim füllt mit der ihm eigenen Energie sein Muster der innerlichen Gestaltung bis an die ihm gesetzten engen Grenzen.
Ich habe versucht, ihm selber, mir und anderen die damit verbundene Leistung deutlich zu machen, diesen Schatz ans Tageslicht der Öffentlichkeit zu fördern. Ich brauche, glaube ich, nicht mehr im einzelnen auszuführen, daß die gemeinsame Arbeit und ihr Ergebnis für Achim therapeutische Wirkung hatte, daß sie bei einigen Lehrern und Erziehern produktives Nachdenken auslöste (natürlich sind wir bei anderen auch auf Unverständnis, Kritik und Gleichgültigkeit gestoßen) und daß sie für uns, die wir mit Achim und an dem Bild arbeiteten, ein ausgewogenes Gefühl von Anstrengung und Befriedigung hinterließ. Meine anfängliche Befangenheit und mein Mitleid Achim gegenüber haben sich in Respekt und Zuneigung gewandelt.
Die Zusammenarbeit mit Achim ist mir zugefallen, weil meine Arbeitsweise solche Zufälle zuläßt. Andere Behinderte hätten eine so intensive Beschäftigung mit ihnen gleichermaßen verdient. Ich hoffe, daß wir in den noch ausstehenden Teilprojekten deutlich machen können, daß bei gleicher Grundhaltung aber veränderter Aufgabenstellung, mit anderen Methoden und Mitteln, noch andere Schätze zu heben sind.
Als Beispiel, wie unsere Arbeit sich im Körperbehindertenzentrum auswirkte, füge ich die Stellungnahme von Elke Heger bei, der Leiterin der Tagesstätte:
Was bedeutet die Gestaltung des Rennfahrer-Bildes für mich?
Die Vorbereitung zu dem Bild war nur möglich durch intensive, intuitive Kommunikation zwischen der Künstlerin und dem jungen Mann Joachim.
Es ermutigt mich, daß ein körperlich so eingeschränkter und emotional so zurückhaltender, fast bedürfnislos wirkender junger Mann aus seiner starken Zurückgezogenheit in sich selbst herauszulocken ist.
Der lange Prozeß der Kommunikation förderte ein Fachwissen über Rennsport zutage, von dem wir bisher nur ansatzweise wußten.
Ich frage mich, warum wir solche Ansätze nicht ernst genug genommen haben, um mit diesem Mittel die Kommunikation mit Achim auszuweiten.
Beeindruckend ist die Assoziation (Ähnlichkeit zwischen der Technik, die Joachim selber zur Verfügung steht und in die er sich beim Rennfahrer geradezu kinästhetisch hineindenkt.)
Ist die kinästhetische Wahrnehmung schwerbehinderter Rollstuhlfahrer“ reicher und tiefer als wir es uns denken? Ist die Erlebnisfähigkeit mancher Menschen mit starken Bewegungsbehinderungen tiefer als meine / unsere—ähnlich wie beim Blinden, der besser hören, tasten kann als ein Sehender?
Können, sollen wir uns bemühen, in unserer „ Förderungs-Arbeit“ noch mehr zutage zu fördern, tiefer zu graben? Wieviel versteckte Fähigkeiten, Vorlieben Sehnsüchte schlummern in allen anderen Kindern und Jugendlichen?
Haben wir genug Zeit für den einzelnen? Wie sensibel, erlebnisfähig, erfahren, reif müssen unsere Mitarbeiter sein? Sollten wir die Träume unserer Kinder und Jugendlichen als eine kreative Kraft nicht ernster nehmen?
Nehmen wir die „ realitätsgerechte Selbsteinschätzung“ als Lernziel zu ausschließlich wichtig?
- Ergebnis
Achims Bild vom Rennfahrer der die Trennung von drinnen nach draußen durchbricht, ist für mich ein Beispiel, wie ein Schwerbehinderter mit Hilfe seiner Phantasie die Grenze seiner Behinderung überwindet. Vielleicht möchten das alle Menschen mit einer Behinderung. Andere haben andere Vorstellungen, wie tanzen, Tiere pflegen oder Blumen binden.
In Achims realen Leben akzeptiert er seine eingeschränkten Tätigkeitsmöglichkeiten – in seiner Vorstellung ist er frei.
Achims Bild bedeutet für mich ein Stück Freiheit des Geistes in einem schwachen Körper.
- Die Ausführung, d. h. die Projektion und Gestaltung des in der intuitiven Kommunikation und Interaktion zwischen der Künstlerin und Joachim gewonnenen Bildthemas läßt die Künstlerin in eine dienende Position zurücktreten
Aber ohne die Ideen zur Verwirklichung und die handwerklich-künstlerische Technik wäre eine solche Bildprojektion mit der dazugehörigen Foto- und Textdokumentation nicht zustande gekommen.
Die künstlerische Diktion der Kunst am Bau, wie sie Frau Keusen schon in ihrer Grundkonzeption vertrat— nämlich Entwicklung und Ausführung von Ideen in der Interaktion mit den Betroffenen – ist an diesem Beispiel in hohem Grade erfüllt und hat für den mitwirkenden jungen Mann und uns als Mitbetroffene eine tiefere, fast kathartische Wirkung erzielt, als ich es mir nach den ersten Entwürfen anläßlich der Ausschreibung vorstellen konnte.
Oldenburg, den 14.9. 1981 Elke Heger
Abschließender Exkurs anstelle einer Literaturliste
„Die beste Tendenz ist falsch, wenn sie die Haltung nicht vormacht, in der man ihr nachzukommen hat, schreibt Walter Benjamin.
Ich will zum Schluß versuchen, mir Rechenschaft zu geben, wer mir die Haltung vorgemacht hat, wem ich etwas zu verdanken habe. In meinem Erfahrungsbericht habe ich weitgehend darauf verzichtet zu zitieren. Ich bin nicht mit dem Anspruch angetreten, eine bestehende Theorie zu verifizieren, noch eine neue zu entwickeln. Wohl bin ich aber der Meinung, daß Erfahrungen der beschriebenen Art Schlüsse, Verallgemeinerungen zulassen, die zur Theoriebildung beitragen können. Anregungen habe ich kaum aus der fachdidaktischen Literatur gewonnen, viel mehr aus anderen Quellen, von lebendigen Beispielen (die natürlich zumeist auch Literatur sind). Hier meine unvollständige und willkürliche Auswahl:
Von Walter Benjamin habe ich viel gelernt (,‚Der Autor als Produzent“ in: „Versuche über Brecht“, Ffm 1966), z. B. daß die Technik, in der eine Aufgabenstellung gelöst wird, etwas zu tun haben muß mit der Tendenz, die der Autor verfolgt.
Über Benjamin habe ich Sergej Tretjakov kennengelernt als Beispiel für einen „operierenden“ Schriftsteller, der die Technik des Schreibens nicht trennt von der (politischen) Tendenz, die er als richtig erkannt hat, für die er arbeitet und kämpft. Tretjakov schreibt nicht nur, sondern er verhilft anderen dazu, zu schreiben, sich auszudrücken, um die Kluft zu verringern zwischen Autor und Publikum. Dafür gibt er organisierende Hilfestellung, schafft Rahmenbedingungen, erschließt Wege für die Veröffentlichung, weil er wie Benjamin der Meinung ist, daß der Lesende jederzeit bereit sei, ein Schreibender, nämlich Beschreibender oder auch Vorschreibender zu werden. Ein Vor-schreibender! Nicht nur Nach-denkener. Die Arbeit mit Achim hat für mich sehr anschaulich gemacht, was das heißen kann. Von einem bestimmten Zeitpunkt an war er der Vorschreibende und Bestimmende und ich ausführendes Werkzeug – viel mehr, als ich das vorher je ahnen konnte – was meine Autoreneitelkeit durchaus nicht verletzte, denn es besteht kein Zweifel, daß er ohne meine organisierende Vorarbeit, meine Einfühlung in seine Situation und ohne meine Geburtshilfedienste seine Vorstellungen und Phantasien nicht hätte zur Welt (Öffentlichkeit) bringen können, zumal sie ihm zum Teil erst während unserer gemeinsamen Arbeit bewußt wurden.
Lesen Sie bei Tretjakov nach: die Geschichte von der Tasche, wie er für eine Jugendzeitschrift Jugendliche anregt, den Inhalt ihrer Hosentaschen zu beschreiben, jedes einzelne Ding, auch das unscheinbarste, nach Herkunft und Gebrauch. Wie damit eine Biografie der Gegenstände entsteht, die soviel erzählt über die Besitzer und Gebraucher dieser Gegenstände. Zu Wort kommen lassen, zum Ausdruck kommen lassen! Das Motto unserer ersten Erkundungen verdanke ich auch diesem Beispiel.
Maxie Wander ist eine Autorin, die die Haltung vorgemacht hat, der ich nachkommen möchte: sie schafft im Gespräch eine Lage, die es anderen Menschen überhaupt erst ermöglicht, Wesentliches von sich zu erzählen. Man kann nur ahnen bei der Lektüre ihres Buches (,‚Guten Morgen du Schöne, Frauen in der DDR“, Luchterhand), wieviel an Vorarbeit, Einstimmung, Mitgefühl, Atmosphäreschaffen nötig gewesen sein mußten, bevor sich ein Gegenüber so rückhaltlos artikulieren konnte. (Sie hat die Technik nicht erfunden, Erika Runge und andere sind vorangegangen.)
Carmen Thomas und ihre Ü-Wagen-Sendungen im WDR verhelfen häufig Menschen zu Wort, die sich sonst nicht öffentlich ausdrücken würden. Es gab hinreißende Sendungen. Ich erinnere mich einer weit zurückliegenden, als sie Probleme von Sprachbehinderten behandelte. Wie da diese flinkschnäuzige Frau minutenlange Geduld aufbrachte, um einen Stotterer ins Mikrofon stottern zu lassen, ohne ihn helfend zu unterbrechen! Man muß sich auch mit dem Helfen Zeit lassen und nicht voreilig vor-denken, vor-handeln, habe ich an diesem Beispiel gelernt.
Meine pädagogische Lieblingslektüre ist Heinrich von Kleists „Allerneuster Erziehungsplan“. Er hat mich gelehrt, nicht zu sehr den „Virtuosen der neuesten Erziehungskunst“ zu trauen, sondern das gemeine Gesetz des Widerspruchs zu achten, des Widerspruchs, den ich mit Gewißheit heraufbeschwöre, wenn ich zu eingleisig-engstirnige Konzeptionen vertrete. Ich ziehe Konzeptionen, die ein Sowohl-als-auch zulassen den Entweder-oder-Konzeptionen vor (hier sei ein Hinweis gestattet auf die Fachdiskussion visuelle Kommunikation oder musische Erziehung).
Ich bin übrigens der Meinung, daß man Kleists Aufsatz nicht nur als Parodie verstehen sollte, sondern daß er, wenn auch in ironischer Form, gültige Gesetzmäßigkeiten aufzeigt.
Hugo Kükelhaus warnt in seinem Aufsatz „Die Phantasie des Leibes“ (in.,, Organismus und Technik“, Fischer alternativ) auf andere Art vor Eingleisigkeit. An vielen eindrucksvollen und einleuchtenden Beispielen macht er deutlich, welche Gefahren drohen, wenn Systeme aus der Balance geraten. Das unermüdliche prozeßhafte Balancehalten zwischen Gegensätzen, die sich gegenseitig bedingen, das Spannungaushalten zwischen Polen ist für ihn Menschenaufgabe, daraufhin sind Menschen organisiert. Kükelhaus hat keine technik-feindliche Einstellung, sondern macht am Beispiel deutlich, daß Menschen in der Lage sind, Technik sich so anzuverwandeln, daß sie „organlogisch“ hilfreich genutzt werden kann. Solche Gedankengänge, auf Architektur bezogen, haben etwas zu tun mit meiner Arbeit für Behinderte. Nicht zu glatt-funktional darf die Architektur sein, sondern sie muß gerade für die unter Wahrnehmungs- und Erlebnisverarmung leidenden Kiöder Wahrnehmungs- und Erlebnisreize bieten, die andere Kinder z. B. in der Natur finden.
Menschen-Maß, Menschenproportionen als Ausgang für Architekturmaß, konnte ich in einer Ausstellung in Zürich studieren, die in Fotodokumenten „Chinesische Hof-Häuser“ darstellte. Der Katalog dieser Ausstellung ist auch in Buchform erhältlich. (Werner Blaser, Hofhaus in China“, Birkhäuser Verlag Basel, Boston, Stuttgart.) Wunderschöne Innen-Außen-Durchblicke; Räume öffnen sich dem Durchschreitenden, Wände sind so gegliedert, daß sie dem Vorbeigehenden wechselnd anregende Seheindrücke vermitteln.
Als ich vor dem Problem stand, lange kahle Flure zu gliedern, habe ich oft an diese chinesischen Beispiele denken müssen.
Immer wieder habe ich auch Studenten zu danken, die in kunstpädagogischen Abschlußarbeiten mich bestärken, daß es besser ist: erst Erfahrungen zu machen, dann Schlüsse zu ziehen, als ein fertiges theoretisches Konzept einer Situation überzustülpen.
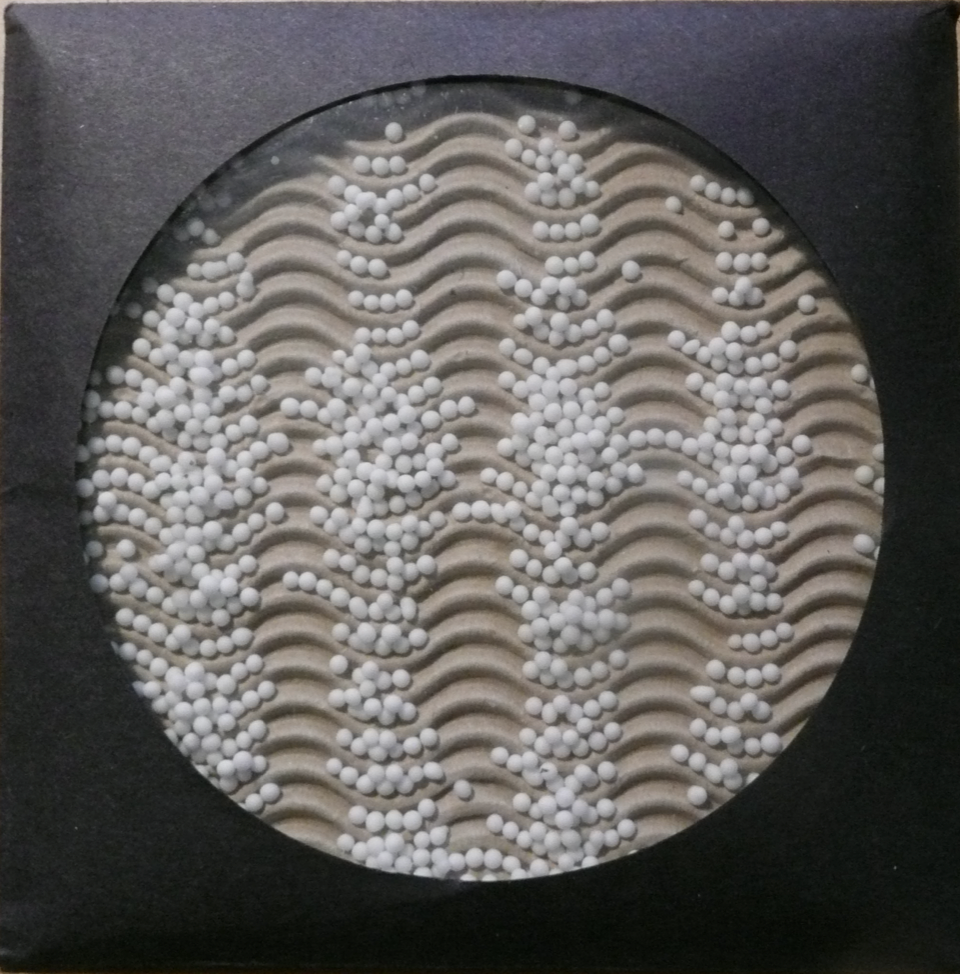
Weiterführend →
Ein Porträt der Hungertuchpreisträgerin Almuth Hickl findet sich hier.
Und außerdem im KUNO-Archiv, ein Hinweis auf die Ausstellung Freibank. Photos der Reihe im Rheintor und der Veranstaltung in Kunstverein Linz. Einen Essay zu den Aktionen im Rheintor finden Sie hier. Das Konzept der Künstlerin zu ihren Computerzeichnungen finden Sie hier.