Vom Abtragen der Monumente oder das Wesen der Chronologie
I
 Felix Philipp Ingold ist ein Autor, dem ich nicht ausweichen kann. Ich habe mich nicht darum bemüht, und es wäre müßig, denn es scheint, als würden er oder seine Texte oder seine Übersetzungen ganz unvermittelt vor mir erscheinen, in Momenten von Plötzlichkeit, die der Zeit den Grund nehmen. Es ist nicht so, dass ich danach greife, weil ein Thema gerade aktuell für mich wäre, nein, im Grunde glaubte ich einiges abgelegt und gegessen zu haben. Ein Fehler!
Felix Philipp Ingold ist ein Autor, dem ich nicht ausweichen kann. Ich habe mich nicht darum bemüht, und es wäre müßig, denn es scheint, als würden er oder seine Texte oder seine Übersetzungen ganz unvermittelt vor mir erscheinen, in Momenten von Plötzlichkeit, die der Zeit den Grund nehmen. Es ist nicht so, dass ich danach greife, weil ein Thema gerade aktuell für mich wäre, nein, im Grunde glaubte ich einiges abgelegt und gegessen zu haben. Ein Fehler!
Anfang der Neunziger kam ich, um meine Schwester zu besuchen nach den Niederlanden. Sie studierte in Delft Architektur, und mich faszinierte die Ballung der holländischen Stadt. Den Haag, Delft, Rotterdam wie an einer Kette an einer Trambahnlinie aufgereiht. Und der Ausflug nach Amsterdam natürlich war Pflicht. Und zu diesem Aufenthalt gehörte auch ein Besuch in der Buchhandlung Boeki Woeki.
Ich war, obgleich ich meinte, das hinter mir gelassen zu haben, noch ganz im Modus des Schatzsuchers. In der DDR, in der ich aufwuchs, verbrachte ich einen Großteil meiner Jugend damit, durch die Antiquariate zu streifen auf der Suche nach raren Texten. Es war keine Bibliophilie, die Auflage oder die Ausstattung des Bandes interessierte nicht. Es war die Gier nach geronnener fremder Welt und Erfahrung. Denn der Osten war ein Käfig, und manches Buch war wie frisches Grün, das uns durch die Gitter gereicht wurde.
Aber zurück nach Amsterdam und in den Boeki Woeki. In einem Stapel von Büchern entdeckte ich Folgendes: Felix Philipp Ingold. Ausgesungen. Mit einer Übersetzung ins Russische von Ilya Kutik und einem Begleitwort von Gennadij Aigi. Erschienen war das Ganze im Berliner Rainer Verlag, den ich natürlich bis dahin auch nicht kannte. Die russische Übersetzung des Titels heißt После голоса, was man mit gutem Gewissen auch mit „Nach der Stimme“ zurückübersetzen könnte.
Ich fand das einzigartig, zumal ich nur die entgegengesetzte Übersetzungsrichtung kannte und wir in der Schule zumindest vor der Ära Gorbatschow mit sowjetischer Literatur geradezu zugeschüttet worden. Allerdings war kein Titel von Aigij dabei. Aber Arsenij Tarkowski in einem Poesiealbum, also einem kleinen Heftchen, das einen Autor kurz vorstellt. Bei Ingold fand ich folgenden Text der mich daran erinnerte:
Kurz und gut, eben war da noch
ein U zu sehn
Im Rückspiegel nimmt die Zukunft schneller zu. Die
Sehne sucht in ihrer Schwingung
Halt. So
wie die Axt im Nacken
des Bruders. Aber
kein Abel
Dieser Text holte mich gewissermaßen da ab, wo ich stand. Auf dem Sprung in eine Zeit, die die Vorsilbe Post- bis zur Erschöpfung gebrauchte, um sich die Illusion zu verschaffen, sich von Geschichte befreit zu haben.
II
Im letzten Jahr begegnete mir der Übersetzer Ingold in verschiedener Form mit Büchern die mich höchst beeindruckt haben. Es waren jeweils Publikationen mit einem gewissen Russlandbezug. Zum einen waren das die im Verlag Mathes und Seitz erschienenen Gefängnistagebücher von Boris Vildé. Der russischstämmige Franzose erwartet das Urteil durch die deutschen Besatzer, das, weil er die Resestance organisiert und eine Zeitschrift mit gleichem Namen herausgegeben hatte, nur den Tod bedeuten könnte. Aber Vildé nimmt das Urteil oder besser die Vollstreckung keinesfalls vorweg, sondern arbeitet im Gefängnis an seiner Vervollkommnung als Mensch. Er liest, rezipiert, schreibt, nutzt jede Möglichkeit zu leben. Es entsteht ein eindringliches Dokument der Zivilisiertheit angesichts faschistischer deutscher Barbarei.
Zum Anderen erschien bei Dörlemann die Anthologie Als Gruß zu lesen. Wie schon in Ingolds Gedichtband Wortnahme. Jüngste und frühere Gedichte, auf die später gesondert einzugehen sein wird, versammelt Ingold hier Gedichte und ordnet sie entgegengesetzt der Chronologie an. Gewissermaßen wie ein Keil gräbt sich das Buch in zweihundert Jahre russischer Dichtungsgeschichte. Die Verschiedenen Ablagerungen werden durch Dichtungen unterschiedlicher Qualität repräsentiert. Gegenstand der Sammlung ist also keine Perlenlese, sondern eher eine Evolutionäre Abfolge. Auf diese Vorgehensweise wird in Zusammenhang mit Ingolds Roman Alias zurückzukommen sein.
III
 Die Anführer der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution, die aufgrund einer Kalenderanpassung im Nachhinein im November gewesen ist, wurden uns unter ihren Decknamen vorgestellt, also nicht als Uljanow und Tschugaschwilli, sondern als Lenin und Stalin.
Die Anführer der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution, die aufgrund einer Kalenderanpassung im Nachhinein im November gewesen ist, wurden uns unter ihren Decknamen vorgestellt, also nicht als Uljanow und Tschugaschwilli, sondern als Lenin und Stalin.
Ihre Klarnamen hatten sie in der Illegalität abgelegt; und dass sie bei ihren Decknamen blieben, auch nachdem sie die Staatsmacht übernommen hatten, hatte Methode.
Dieses Motiv zieht sich letztlich durch den Roman Alias, auch wenn der Held alles andere als ein Führer ist. Er ist ein sowjetischer Schriftsteller, der versucht, den gesellschaftlichen Maßgaben, die an ihn durch Partei und Schriftstellerverband an ihn herangetragen werden, gerecht zu werden. Über weite Strecken versteht er sich als sozialistischer Realist und baut in diesem Sinne die Geschichten der Werktätigen in Heldengeschichten um. Unter anderem schreibt er unter dem Pseudonym Choloschow die Novelle „Ein Menschenlos“.
Ich bin in einem sozialistischem Land aufgewachsen und in eine Sozialistische Schule gegangen. Und zum sozialistischen Kanon in der Literatur gehörte neben Ostrowskis „Wie der Stahl gehärtet wurde“ Scholochows „Ein Menschenschicksal“. Für uns Schüler gab es eine zentrale Stelle in diesem Buch. Zwei Sowjetsoldaten stehen am Waldrand und nur einer von ihnen hat nur eine Zigarette. Er bricht sie in der Mitte durch und gibt eine Hälfte dem Kampfgenossen mit den Worten: „Alleine Rauchen ist wie alleine Sterben.“ Das wurde zum geflügelten Satz in der Klasse, wenn einige von uns in der großen Pause hinter der Turnhalle verschwanden.
IV
Die Geschichte der Sowjetunion begann mit einem Putsch. Der Zar hatte im Februar 1917 abgedankt, und eine provisorische Regierung unter der Führung des Sozialdemokraten Kerenski hatte die Führung übernommen. Dem standen die sogenannten Maximalisten gegenüber, die keine bürgerliche Demokratie akzeptierten und gleich ins Arbeiterparadies wollten. Auf einem Kongress der Sozialdemokratischen Partei Russlands konstituierten sich dies Maximalisten auf Grund eines Abstimmungsergebnisses als Bolschewiki (Mehrheitliche) und im Oktober (oder November) 1917 führten sie einen Staatsstreich durch. Nicht ganz geplant, Lenin war noch im finnischen Exil, wurde aber bald zurückgeholt.
Aus Russland wurde die Sowjetunion, ein sich ständig erweiterndes Kolonialreich, das an seinem Höhepunkt und Ende ca. ein Fünftel der Welt bedeckte und in dessen westlichsten Zipfel, einer autonomen Republik, die sich selbst deutsch und demokratisch nannte (ein Deckname?), wuchs auch ich auf.
V
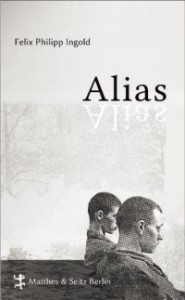 Der Roman Alias setzt ungefähr in der Mitte der Zeit ein, die dem roten Weltreich beschieden war, und er beginnt mit einem Mord. Soldaten auf einem Vorposten nehmen einen deutschen Aufklärer gefangen, ersuchen ihn zu verhören, bewundern seine gute Ausrüstung, haben aber keinen Kontakt zur nächsten Truppe, müssten also ihre ohnehin knappen Vorräte mit ihm teilen. Also bringen sie ihn um.
Der Roman Alias setzt ungefähr in der Mitte der Zeit ein, die dem roten Weltreich beschieden war, und er beginnt mit einem Mord. Soldaten auf einem Vorposten nehmen einen deutschen Aufklärer gefangen, ersuchen ihn zu verhören, bewundern seine gute Ausrüstung, haben aber keinen Kontakt zur nächsten Truppe, müssten also ihre ohnehin knappen Vorräte mit ihm teilen. Also bringen sie ihn um.
Berger, der hier Beregow heißt, erhält den Auftrag den Deutschen zu erschießen. Shon am Beginn also, und unter dem Druck der Umstände, wie man immer rechtfertigen wird, erlischt der moralische Anspruch der späteren Befreier.*
„Der grausamste Monat ist der April, er ist aber auch der lächerlichste, der lieblichste. Nicht anders – also wie üblich – wars im Kriegsjahr 1942.“
Im Folgenden begleiten wir Berger alias Beregow durch die restlichen Jahre des Krieges, durch den Stalinismus, ins Lager durchs Tauwetter, nach Israel, bevor sein Leben nach Aufenthalt am Bodensee auf einem Ausflug in die Gedenkstätte des KZ Mauthausen endet.
Berger war als Soldat Beregow an dessen Befreiung beteiligt bzw. fast, die Amerikaner hatten das Lager befreit, und die Russen stießen später dazu. Berger arbeitet als Übersetzter und lernt dort seine spätere Frau kennen, die als Häftling im Fotostudio des Lagers tätig war und in einer Widerstandsgruppe arbeitete, die es sich zum Auftrag gemacht hatte, die Verbrechen der Nazis zu dokumentieren.
Alias ist ein Roman voller Scharaden. Bergers Frau verliebt sich in einen ehemaligen Häftling aus dem Gulag, der auch ein ehemaliger Frontkamerad ist. Sie verlässt Berger, der später aufgrund einer Denunziation selbst ins Lager einfährt. So biegt sich die Geschichte im Grunde immer wieder auf Anfang, und wie die reale Geschichte der Sowjetunion mit einem Putsch beginnt, und Bergers Geschichte mit einem Mord, erlauben beide im Grunde keinen Ausgang. Sie müssen auf sich selbst zurückgeworfen, enden und Russland findet in einen Vorrevolutionären Zustand zurück. Das ist natürlich keine Erlösung, aber es ist eine Befreiung vom Erlösungsversprechen.
Erzählt wird aus Hinterlassenschaften. Dieser Roman ist Archäologie und Rekonstruktion. Eine Welt von ihrem Ende her betrachtet.
Ich weiß nicht ob das Buch für mich zum richtigen Moment kam. Ich habe lange Zeit gebraucht, um meine eigenen Gedanken aus der Umklammerung der Ideologie zu lösen. Wahrscheinlich hätte ich es vor 20 Jahren gar nicht gemocht und kaum verstanden. Man muss frei sein, denke ich, um diese Kunst zu genießen. Aber es ist ein großartiges Buch, das letztlich die theatralische Dramatik des 20. Jahrhunderts wenn nicht auf den Punkt, so doch in eine Kugel bringt. Und da haben wir über die Sprache, die den Roman trägt, noch gar nicht gesprochen.
VI
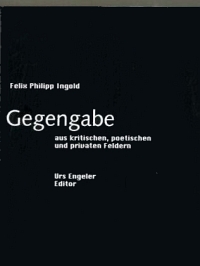 Langsam bekomme ich Zweifel, ob der Kontinent Ingold mit herkömmlichen Mitteln von mir überhaupt zu überqueren ist. Vielleicht aber scheitere ich einfach nur an meiner Ungeduld. Und es ist ja überhaupt nicht nötig, alles zu kennen, zumindest nicht sofort, und da es sich verändert, ist es für den Moment auch gar nicht möglich. Es ist immer noch die alte Sammelwut, die in mir aufkeimt und die auf Vollständigkeit abzielt. Ein Reflex auf den Totalitarismus meiner Jugend vielleicht. Einem Totalitarismus, den Berger, die Hauptfigur aus Ingolds Roman Alias, zeitweise mitgetragen hatte, und dem er sich erst kurz vor seinem Tod entziehen konnte, oder eben nicht entziehen. Es gibt kein Entkommen, wenn sich alles fügt, die Sammlung findet erst ein Ende, wenn die letzte Briefmarke hinzugekommen ist, und damit endet auch das Sammeln.
Langsam bekomme ich Zweifel, ob der Kontinent Ingold mit herkömmlichen Mitteln von mir überhaupt zu überqueren ist. Vielleicht aber scheitere ich einfach nur an meiner Ungeduld. Und es ist ja überhaupt nicht nötig, alles zu kennen, zumindest nicht sofort, und da es sich verändert, ist es für den Moment auch gar nicht möglich. Es ist immer noch die alte Sammelwut, die in mir aufkeimt und die auf Vollständigkeit abzielt. Ein Reflex auf den Totalitarismus meiner Jugend vielleicht. Einem Totalitarismus, den Berger, die Hauptfigur aus Ingolds Roman Alias, zeitweise mitgetragen hatte, und dem er sich erst kurz vor seinem Tod entziehen konnte, oder eben nicht entziehen. Es gibt kein Entkommen, wenn sich alles fügt, die Sammlung findet erst ein Ende, wenn die letzte Briefmarke hinzugekommen ist, und damit endet auch das Sammeln.
Der Autor begegnet uns als Text, und der Text ist das, was wir gerade lesen, plus die vergangenen Lektüren. Was kommt können wir nicht wissen, ist maximal eine Ahnung. Das ist Freiheit.
VII
Vor mir liegen zwei schwergewichtige Bände aus dem Verlag Urs Engeler Editor. Ein Verlag im Übrigen, dessen Abwesenheit mir zuweilen rechte Sehnsuchtszustände einbringt, bescherte er mir doch einige der intensivsten Leseerlebnisse der letzten Jahre. Es wäre müßig an dieser Stelle einzelne Bücher zu nennen, das gesamte Programm war furios.
So furios wie eben jene zwei Ingoldbände, die jetzt vor mir auf dem Tisch lasten. Zum einen „Wortnahme“, ein Band mit Gedichten, und zum anderen der Band „Gegengabe. Aus kritischen poetischen und privaten Feldern.“ Es ist noch nicht ganz abzusehen, was diese Bücher mit mir anstellen werden.
VIII
Gegengabe ist ein Buch, wie ich mir schöner keines senken kann. Irgendwann in meiner Abiturzeit hatte ich einmal einen Reclamband gekauft, der einen Abdruck der Texte aus der Zeitschrift Athäneum enthielt. Auch dieses war eine Art Schlüsselerlebnis. Texte, die sich in kein Genreghetto pressen ließen. Versammelt in einem Band. Natürlich freute ich mich damals aufgrund meiner Jugend vor allem über das Aphoristische, das ich mir bedeutsamer Mine zitieren konnte, Freiheit war noch Ahnung.
IX
Essay, Gedicht, Erzählung. Übersetzung.
Und die Vielfalt der Form des Geschriebenen spiegelt sich in der Vielfalt der Leseerfahrungen. Und kein Text findet man in diesen beiden Büchern, den man als zentral bezeichnen könnte. Es ist eine beständige Verlagerung des Schwerpunkts. Eine Art tänzelndes Denken.
X
Gerade liegt mein Fokus auf einem Text, der Babel heißt und sich seinen Titel von dem russischen Schriftsteller Isaak Babel entliehen hat. Dieser Text beschreibt eine Reihe von Begegnungen mit Elias Canetti. Gegen Ende des Textes im vorletzten Abschnitt heißt es: „Was Canetti über Isaak Babel geschrieben hatte und was er mir über ihn berichten konnte, brauchte nicht wirklich geschehen zu sein, es hätte auch hergeleitet werden können aus dessen stark autobiografischen Erzähltexten und ergänzt durch Wunschdenken und Phantasie. Canetti betonte im Übrigen selbst, dass Erinnerung nur als Erfindung beanspruchen könne, und er sprach auch von der Enttäuschung über ein Leben, das zwar dokumentierbar, als dokumentiertes aber umso unwirklicher war.“
XI
Es hat sicher seinen Grund, dass ich an jener Stelle in den Aufzeichnungen und zwischen den im Buch abgedruckten Photos verweile, denn dieser Gedanke (kann man ihn schon als Grund einer Poetik betrachten?) ist mir in allem, was ich lese, aber auch in dem, was ich zu schreiben versuche, sehr nahe. Und ähnlich dem Icherzähler des Textes in seinen Begegnungen mit Canetti, geht es mir mit anderen Autorinnen und Autoren, aber auch mit Canetti und Ingold. Ich bin beständig versucht, ein Gespräch zu beginnen, und manchmal gelingt es.
XII
Der zweite Band, der auf meinem Tisch liegt (lastet ist kein Wort der Wahl an dieser Stelle) heißt Wortnahme und versammelt Gedichte Ingolds aus dem Zeitraum zwischen 2005 und 1999. Sie sind in chronologisch umgekehrter Reihenfolge angeordnet. Man liest sich also, wenn man von Anfang liest, in eine Vergangenheit hinein, in diesem Fall, in eine jüngst vergangene. (Dieses Prinzip findet später in der Anthologie „Als Gruß zu lesen“ erneut Anwendung. Auch hier findet sich Evolution als Verschiebung verstanden, nicht als Fortschritt.)
XIII
So also können 5 Jahre Produktion lyrischer Texte aussehen. Die Texttitel wirken hierbei zuweilen wie thematische Begrenzungen. Es folgen dann mehrerer Gedichte unter einem Titel, als beschrieben sie ein Feld, ein poetisches und poetologisches, zuweilen auch ein religiöses.
Tastend, (wenn Sprache tasten kann) schiebt ein Text sich vorwärts, was bei der Reihenfolge und Anordnung ein Rückwärts ist, und führt dabei den Gedanken eines Erkenntnisfortschritts durch die Zeit ad absurdum.
Unser Wissen ist kein Berg, an dessen Gipfel wir stehen und zurückblicken, nein, es ist Fläche, und das besondere daran: ein jeder Punkt ist gleich weit weg vom Rand. Aber: und das scheint Paradox, eines ergibt sich aus dem anderen. Verschiebung ist in jede Richtung möglich. Somit erweist sich Zeit im Ende als Erfindung, als reines Ordnungsprinzip. Und wir können damit operieren wie mit einer Anordnung von Vokalen.
Out
Noch eine Nacht zu
Genua. Genau
mit lauteren Erinnerungen
ausgemalt. Die Augen
zum Beispiel
die baden wie Spatzen im Staub.
Den Gau
vermisst flatternd der x-fache
Blick. Keine Rede
von Gerettetsein. Das Meer bleibt
eins. Geteilt
von so viel Kielen.
Und immer wieder finden sich Anspielungen aufs alte Testament. Ich lese und lese.
***
 Dieser Essay wurde ausgezeichnet mit dem KUNO-Essaypreis 2013. Die Begründung findet sich hier.
Dieser Essay wurde ausgezeichnet mit dem KUNO-Essaypreis 2013. Die Begründung findet sich hier.
Lesetipps:
Ausgesungen, von Felix Philipp Ingold, German/Russian, Russian by I.Kutik, Begleitwort by G.Ajgi, Berlin 1993
Als Gruß zu lesen, von Felix Philipp Ingold, Russische Lyrik von 2000 bis 1800, Zürich 2012, Dörlemann
Gegengabe, von Felix Philipp Ingold, Aus kritischen, poetischen und privaten Feldern, Urs Engeler Editor 2009
Alias, oder Das wahre Leben, von Felix Philipp Ingold, Matthes & Seitz, Berlin 2011