Anmerkung der Redaktion: Mit dem Kollegengespräch zwischen Enrik Lauer und A.J. Weigoni gilt es ein Versäumnis nachzuholen. Damals fehlte die Sparte ‚Sekundär-Archäologe‘ im Projekt Kollegengespräche.
Weigoni: Lass uns über einen Ehrentitel reden: Sach-Buch-Autor. Ein Kofferwort aus drei Begriffen. Es geht also um Ur-Sachen?
Lauer: Nicht nur der Höflichkeit halber wollen wir vor die Ur-Sachen die Ur-Heber setzen. Wir sind zwei, Heber und Heberin. Nicht dass wir mit diesem Sach-Buch völlig neue Sachen zutage gefördert hätten. Aber sein Inhalt ist zumindest das Ergebnis gemeinsamer sorgender Aufzucht. – Nun zur Frage: Dass Wagner selbst ausschließlich Ur-Sachen verhandelt, liegt auf der Hand. Fast alle seine Protagonisten handeln im Banne verpatzter Ursprünge und Vorgeschichten. Seine Opern sind archäologische Erkundungen von Welten in ihrer jeweiligen Endzeit. Anders gesagt: Wenn der Vorhang sich hebt, sind alle Bedingungen der Möglichkeit des Scheiterns bereits geschaffen. Auch Wagner selbst hatte stark zwanghafte Züge. Denken wir nur an sein desaströses Verhältnis zum Geld oder seine double-bind-artige Haltung zur Sexualität. Solche Tiefenstrukturen in Leben und Werk versuchen wir – heiter im Ton, aber ernsthaft in der Sache – auszuleuchten. Und weil es nun mal die (Vor-)Geschichte unserer Welt ist, die Wagner erzählt, fallen die Schatten unserer Lichter auch auf uns und unsere Zeit. Also ja: Ur-Sachen. Was den dritten Teil des Kofferwortes betrifft: Inwieweit wir als Sekundär-Archäologen auktorial oder epigonal arbeiten, ist wieder eine andere Frage …
Weigoni: Regine Müller, um Deine Co-Autorin zu nennen. Wie kann man sich die gemeinsame Arbeit vorstellen?
Lauer: Daran ist wenig Geheimnisvolles. Ich habe, nach vielen Gesprächen mit Regine, die Themen und die inhaltliche Richtung des Buches in einem relativ ausführlichen Exposé skizziert. Da ich selbst jahrelang auf der anderen Seite des Schreibtisches saß, weiß ich, wie Lektoren in der Phase der Programm- und Titelplanung ticken. Ohne ein aussagefähiges Exposé ist es undenkbar, heutzutage noch einen Verlag für ein Sachbuch zu finden – einen so überaus renommierten Verlag wie C.H. Beck zumal. An dem Exposé habe ich dann mit Regine, schließlich mit dem zuständigen Lektor bei Beck noch mal gründlich gefeilt. Beim Schreiben haben wir dann die zehn Kapitel schlicht hälftig unter uns aufgeteilt. Und zwar gleichsam kontraintuitiv. Abgesehen vom Kapitel über den „Tristan“, das sich überwiegend der musikalischen Bedeutung des Werkes widmet, sind die Werkanalysen von mir, die Kapitel über Leben, Person und Denken Wagners von Regine, die ja nicht nur eine anerkannte Kulturjournalistin, sondern auch Musikerin und Theaterprofi ist. Doch Wagner als sein eigener Librettist und Dramaturg ist eben auch ein legaler Gegenstand literaturwissenschaftlicher Analyse. Die fertigen Kapitel haben wir wechselseitig gegengelesen. Wo ich mich – sehr punktuell – an musikalische Betrachtungen gewagt habe, hatte ich, der Laie, in Regine zum Glück eine professionell kundige Kritikerin. Ansonsten haben wir uns beim anderen inhaltlich wie stilistisch weitgehend rausgehalten. Im Übrigen können wir den Lektor bei Beck – von Haus aus ein promovierter Altertumswissenschaftler – gar nicht genug loben. Er hat unser Buch in heutzutage beinahe schon altertümlich liebevoller Weise betreut. Und zwar von der konzeptionellen und inhaltlichen Spurführung bis hin zu den stets verständigen Detailkorrekturen. Schließlich merkt man der handwerklichen Seite der Buchgestaltung an, dass C. H. Beck 2013 sein 250-jähriges Bestehen feiert. Da wirkt eine Tradition, die niemals aus der Zeit fallen kann.
Weigoni: Die Kompositionsskizze des ersten Tristan-Aufzugs schenkte Wagner zu Silvester 1857 seiner Muse Mathilde. Woraufhin sich die vielfältigen Spannungen zwischen den Eheleuten Mathilde und Otto Wesendonck, Minna und Richard Wagner bald so verschärften, dass der Komponist nach Venedig floh, um dort in einem – wiederum von Wesendonck bezahlten! – Palazzo den zweiten Aufzug zu komponieren. Wer sponserte Euch?
Lauer: Wie gerne würde man mal, und sei es nur für ein Jahr, auf Wagners Level schnorren! Aber das ist wohl nicht erreichbar. Zudem leben wir in prosaischen Zeiten. Also: Der Verlag hat uns einen angemessenen Vorschuss gezahlt. Wobei „angemessen“ aber auch meint, dass davon zwei Leute unmöglich so lange leben können, wie sie allein am Buchmanuskript selbst arbeiten. Weshalb für uns beide das Tagesgeschäft – der Kulturjournalismus bei Regine, das prosaische Ghostwriting bei mir – mehr oder minder weiterging. Anders gesagt: Wir haben uns selbst quersubventioniert.
Weigoni: Die Quellenlage zu Wagner ist sehr unübersichtlich. Reicht das, um im Rückblick eine erzählerische Ordnung zu schaffen?
Lauer: Rein philologisch ist die Quellenlage in der Tat unbefriedigend. Bis heute gibt es keine verlässliche historisch-kritische Ausgabe von Wagners gesamtem Schaffen. Die von Egon Voss geleitete „Richard Wagner Gesamtausgabe“ seiner musikalischen Werke – 1970 (!) gestartet – ist noch nicht abgeschlossen; immerhin liegen alle Hauptwerke und viele Quellen dazu vor. Bei den Schriften und Briefen sowie Cosima Wagners Tagebüchern muss man sich dagegen nach wie vor durch ein historisches Sammelsurium mehr oder minder verlässlicher Ausgaben wühlen. Eines von rund 52.000 Seiten zudem, das Sven Friedrich 2004 immerhin auf jener CD-ROM versammelt hat, nach der auch wir meist zitieren. Das Bayreuther Archiv haben wir nicht durchforstet. Von Winifreds berühmt-berüchtigtem, nach wie vor verschlossenen „Giftschrank“, der unter anderem ihren Briefwechsel mit Hitler enthalten soll, ganz zu schweigen. Da unser Buch aber keine (musik-)wissenschaftlichen Ansprüche erhebt, konnten wir mit der beschriebenen Quellenlage leben. Was die Sekundärliteratur betrifft, ist ohnehin Land unter. Allein die Bayerische Staatsbibliothek verzeichnet gut 8.800 Titel. Vermutlich ist über Wagner, ähnlich wie bei Goethe oder Bach, alles schon mal behauptet worden, einschließlich des Gegenteils. Unser Ansatz ist aber erstens journalistisch und zweitens propädeutisch. Das heißt: Wir schrauben keine Opern taktweise auseinander, wir verzetteln uns nicht in biographischen oder akademischen Details. Und wir setzen beim Leser nichts voraus. Aber wir haben unseren Meister schon sehr akribisch gelesen. Und da wir aus unseren akademischen Wurzeln – etwa der kritischen Psychoanalyse, dem Poststrukturalismus oder der Medientheorie – kein Geheimnis machen, heißt das auch, dass wir eher skrupulös und vor allem textnah zu deuten versuchen.
Weigoni: Pünktlich zum Jubiläum ist Richard Wagners Tristan-Handschrift erschienen. Muss die Musikgeschichte nun umgeschrieben werden?
Lauer: Den Krimi um Tristan und Isolde hat Volker Hagedorn im Januar in der ZEIT sehr schön nacherzählt. Für die Kenntnis, wie Wagner im Einzelnen komponierte bzw. notierte ist so ein Autograph, zumal derart prachtvoll ediert, natürlich eine hochrangige Quelle. Aber auf das Werk insgesamt verändert seine Publikation den Blick nicht. Dafür wirft die Geschichte um sein Verschwinden nach 1945, sein Wiederauftauchen 1955 in Barcelona, seine Rückführung aus Francos Spanien nach Bayreuth 1973 ein Licht auf die Wagnerschen Familienbande. Ein Wort, dem nach Karl Kraus bekanntlich „ein Geschmack von Wahrheit beikommt“. Ich selbst musste über die Geschichte, ehrlich gesagt, eher schmunzeln.
Weigoni: Du warst letztens in Dortmund, wie ist die Aufführung des Parsifal von Thomas Hengelbrock mit historischen Instrumenten zu bewerten?
Lauer: In sehr vielen Details des Klangbildes führt der historische Apparat zu durchaus interessanten Unterschieden zum Gewohnten. Auch dass die Streicher weitgehend ohne Vibrato spielen – eine Praxis die ja erst in den Zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts zur Regel wurde und über die Zeitgenossen wie Schönberg oder Strawinsky kräftig ätzten – dient gewiss der musikalischen Wahrheitsfindung. Ebenso wie die insgesamt sehr zügigen Tempi. Wobei aber sogar der Weihepriester Hans Knappertsbusch 1962 in Bayreuth nur 15 Minuten länger unterwegs war. Andererseits unterscheiden sich die historischen Instrumente der Wagnerzeit auch nicht mehr so dramatisch von ihren heutigen Geschwistern. Die von Hengelbrock verwendeten Oboen werden ja bis heute von den Wienern gespielt, sieht man von der Wagnerschen Alt-Oboe als Ersatz für das Englischhorn ab; ebenso die tiefer gestimmten traditionellen F-Hörner. Also: In der Summe klingt das alles in meinen Ohren längst nicht so radikal anders, wie viele wohl erwartet hätten. Was aber schlicht daran liegt, dass Wagner eben kein Renaissancemeister war. Und dass die letzten milden Ausläufer der Schockwelle historischer Aufführungspraxis längst auch die Randplätze der Erztraditionalisten erreicht haben. Klar geworden ist mir in dieser konzertanten Aufführung jedoch etwas ganz anderes. Die über weite Strecken völlig statische Dramaturgie des „Parsifal“ hat auch mich lange denken lassen, die Oper sei eigentlich eine Art getarntes Oratorium. Aber das ist sie nicht mal im Ansatz! Schon rein musikalisch funktioniert das Werk im Konzertsaal nämlich nicht. Der „Parsifal“ ist Wagners einzige Komposition, die er vollständig auf die sehr speziellen klangräumlichen Verhältnisse Bayreuths abstellen konnte. Anstelle der für Wagner perfekten Klangmischung aus dem abgedeckten Graben mischt sich der Klang eines Opernorchesters auf einem Konzertpodium aber so gut wie gar nicht. Auch die „Höhenchöre“ in den Gralsszenen können schlicht nicht von einer Empore kommen. Thai-Gongs als Gralsglocken – OK, Geschmacksache. Aber Gralsglocken auf der Bühne? Njet! Am Ende gaben selbst die sehr verzichtbaren Turnübungen mancher Sängerinnen und Sänger darüber Auskunft, wie viel dramatische Energie in Wagners Werk steckt. Man hätte die Künstler wohl an schwere Notenpulte ketten müssen, um ihnen diese Energieflüsse abzuklemmen.
Weigoni: Die großen Werke, die ehernen Ideen … Wie fragt man nach der historischen Bedingtheit?
Lauer: Keine Frage, dass Wagner in Vielem knietief im Sumpf des 19. Jahrhundert steht. Nicht zuletzt gilt das, wie Regine gezeigt hat, für seinen ebenso fatalen wie folgenreichen, aber eben auch fast schon bestürzend unoriginellen Antisemitismus. Andererseits sehen wir gegenwärtig ja wieder schärfer, wie sehr wir selbst immer noch aus dem 19. Jahrhundert kommen: aus der bürgerlichen Welt mit all ihren sozialen und ökonomischen Triebkräften, mit all ihren psychischen oder ideologischen Fliehkräften. Darwin, Marx und Wagner waren nicht umsonst fast aufs Jahr genaue Zeitgenossen. Nietzsches Tod 1900 und Freunds entsprechend vordatierte „Traumdeutung“ bilden nicht umsonst symbolische Mittelachsen zwischen dem „langen“ 19. und dem „kurzen“ 20. Jahrhundert. Ebenso wenig wie Rassisten vom Schlage Gobineaus oder des Wagner-Schweigersohns Houston Stuart Chamberlain bloße Unfälle der Geistesgeschichte dieser Zeit waren. Wagners Aktualität ist daher keine hohle Phrase für einen routinierten Opern- und Kulturbetrieb. So wie wir ihn in unserem Buch deuten, ist und bleibt er ein Zeitgenosse – auch mit seinen vielen Schattenseiten. Besser gesagt: Er selbst fordert uns explizit auf, ihn immer wieder zum Zeitgenossen zu machen. Und da geht es nicht um Ausstattungsvarianten wie Bärenfelle oder Gestapo-Mäntel, Schwerter oder Smartphones. Für mich sind Wagners Opern immer auch hochdramatische Denksportaufgaben. Regine würde jetzt den Arzt rufen. Aber im Kulturschutzgebiet KUNO offenbare ich meine irrsinnigste Wagner-Vision: eine „Parsifal“-Inszenierung auf dem Jerusalemer Tempelberg. Natürlich dirigiert Daniel Barenboim sein West Eastern Diwan Orchestra. Die vermeintliche „Jüdin“ Kundry wird von einer Inderin gesungen, der verhinderte Tempelritter Parsifal von einem Palästinenser, der Kastrat Klingsor von einem bekennenden Erzkatholiken, die Gralsritter vom Israeli Opera Chorus. Für bekennende Fundamentalisten aller Weltreligionen gibt es je 100 Freikarten. Wenn das „Erlösung dem Erlöser“ verklungen ist, werden Mitwirkende und Publikum nach Zufallsprinzip auf die Heiligen Stätten der Stadt sowie die angesagtesten Clubs von Tel Aviv verteilt. Und diese Begegnungen liefern das Bonusmaterial zur Live-DVD.
Weigoni: Es scheint, als finde im Zeitalter der Kanonisierung Kultur nur noch anlässlich runder Jahreszahlen statt, die Zeitgeschichte hat Mühe sich gegen die Erinnerungskultur zu behaupten. Was wird aus Wagners Forderung: „Kinder, schafft neues!“?
Lauer: Dass Jubiläen unter den Bedingungen einer „Ökonomie der Aufmerksamkeit“ Hauptknotenpunkte im Informationsstrom bilden, sollte niemanden ernstlich verwundern. Ebenso wenig wie nostalgische, aber letztlich zwecklose Versuche, alte Kanons zu reaktivieren oder neue zu etablieren. Nur: Die Oper ist hier die Ausnahme, die die Regel bestätigt! Dass der Kanon ihres Repertoires so erschreckend stabil ist, muss zunächst als Krisensymptom des Genres gedeutet werden. Alexander Kluge hat mal gesagt, es gebe drei Arten von bürgerlichen Palästen: Justizgebäude, Börsen und Opernhäuser. Halbwegs krisenfrei funktionieren derzeit wohl nur noch die Justizpaläste. Grob geschätzt, auch diese Zahlen habe ich von Kluge, sind seit 1600 an die 86.000 Opernwerke komponiert worden. Circa 7.000 davon sind bekannt. Das erweiterte Kernrepertoire der Opernhäuser rund um den Globus beschränkt sich auf vielleicht 100 Werke. Mozart, Verdi, Wagner, Puccini, der „Rosenkavalier“ – da ist die Hütte fast immer voll. Monteverdis „Krönung der Poppea“ wurde dagegen kürzlich, ebenfalls in Dortmund und übrigens grandios, vor einem auf der Bühne sitzenden Publikum inszeniert. Bei 270 Zuschauern lässt sich da für ein, zwei Spielzeiten die Auslastung nahe 100 Prozent halten. Doch spätestens wenn man die nach 1945 komponierten und nicht bloß uraufgeführten Opern zählt, kommen einem die Tränen. Machen wir uns nichts vor: Die Oper ist in unserer musealen Zeit die allermusealste Kunstgattung. Aber das könnte man ja auch mal als Chance sehen. Nämlich indem man sagt: Im Opernhaus habt Ihr letztmalig die Chance, die Ordnung der Dinge im endenden bürgerlichen Zeitalter halbwegs zu durchschauen.
Weigoni: Danke für das nachgeholte Kollegengespräch. Eurem süffig geschiebenen Buch wünsche ich viele Leser.
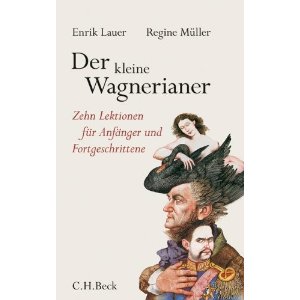 Der kleine Wagnerianer: Zehn Lektionen für Anfänger und Fortgeschrittene, von Enrik Lauer und Regine Müller, Beck C. H., 2013
Der kleine Wagnerianer: Zehn Lektionen für Anfänger und Fortgeschrittene, von Enrik Lauer und Regine Müller, Beck C. H., 2013
