Das zwanzigste Jahrhundert stirbt scheibchenweise. Und mit jedem Stück, das mir schwer schien, bedeutsam und erhaben, und das die Leichtigkeit der Vergängnis angenommen hat, und fortgeweht ist, wird eine weitere Schicht sichtbar. Ein Jahrhundert aus Blätterteig, gefüllt zuweilen mit Senf, manchmal mit Marmelade aber zwischendrin unglaublich viel Luft. Aufgeplusterte Bedeutsamkeit, vor allem am Ende, geliehen aus anderen Jahrhunderten und das Konzept Zeit in Frage stellend. Abläufe. Die Ränder des Jahrhunderts auch, sind kaum auszumachen, sind mürbe, porös und abgestoßen. Man bekommt es nicht zu fassen. Immer nur Fetzen, immer nur Krümel. Und manchmal schon wünschte ich mir, es würde in eine Faust passen, um endlich entsorgt zu sein. Ein frommer Wunsch. Es will einfach nicht vergehen, dieses Jahrhundert, so wie es auch nicht beginnen wollte.
Lew Isaakowitsch Schestow, der eigentlich Jehuda Leib Schwarzmann hieß, gehört diesem Jahrhundert an, obwohl er bereits 1866 in Kiew geboren wurde. Er starb 1936 in Paris und er war …
Ja was war er? In seinen Schriften entzieht er sich der Bestimmung, weil er die Kategorien einfach nicht erfüllt. Er war Philosoph, Religionsphilosoph, Literaturwissenschaftler und Kritiker, und er war nichts von alldem. Vielleicht trifft auf Schestow das Wort Literat noch am besten.
Felix Filipp Ingold, der Schestow übersetzt und herausgegeben hat, schreibt in seinem Vorwort:
„Mit Nietzsche ging Schestow, der als philosophischer Autodidakt gleichsam naturgemäß zum Frei- und Querdenkertum neigte, einig nicht nur in seiner Fundamentalkritik an der europäischen Schulphilosophie, sondern auch in seiner Vorliebe für Musik und Tanz, von der sein sprunghafter Stil – im Denken nicht anders als in der Schreibbewegung – deutlich geprägt war.“
Und das ist fürs erste das bemerkenswerte an Schestows Texten, die in diesem Band: „Siege und Niederlagen“ zusammengefasst sind. So wie er nicht einzuordnen ist, ordnet er nicht ein. Übertritt jegliche Gattungsgrenze, macht aus philosophischen Texten literarische und aus literarischen solche der Erkenntnistheorie. Und: noch einmal aus Ingolds Vorwort:
„Man könnte den Eindruck gewinnen, Schestow lasse ’seine‘ Autoren durchweg und bedenkenlos in seinem Namen, an seiner Stelle argumentieren. Er selbst hat dieses wissenschaftlich unhaltbare Vorgehen als ›Seelenwanderung‹ gerechtfertigt, sein Freund und Kollege Berdjajew fand dafür den passenden, leicht ironischen Ausdruck „Schestowisierung“, was für eine vereinnahmende „Überschreitung“ oder für eine Art von synthetisierender Nachschrift stehen mag.“
Mein Philosophieprofessor Alfred Schmidt, Horkheimerschüler und Theoretiker des Kritischen Materialismus, sagte uns immer wieder vor allem in Hinblick auf die französische Tradition, wir sollten die Werke nicht wie einen Steinbruch benutzen und uns nicht nach Gutdünken einzelne Gedanken herausbrechen, sondern ein Denken in Gänze rekonstruieren. Nur so würden wir den Texten gerecht. Und er hatte wohl recht, wenn es darum ginge, den Texten gerecht zu werden in philosophischer Redlichkeit.
Aber wenn die Zeit schon derart zerfasert, wie soll dann der Gedanke auf den Punkt kommen? Schmidts eingeforderte Redlichkeit führte immer weiter weg in einen fremden Kopf hinein und von dem, was wir Realität nennen, und was vielleicht auch eine Realität ist. Natürlich hat das seinen Reiz, aber was Schestow macht, ist ein Abenteuer auf ungesichertem Gelände. In dem er die Texte um sich selbst herum gruppiert, setzt er sich ihnen aus. Und dieses Abenteuer lesend mitzuerleben ist gleichfalls abenteuerlich.
Wenn Schestow sich zum Beispiel Hamlet zuwendet, dann also der Figur Hamlet, den vorgestellten Menschen, nicht vordergründig dem Stück als Literatur aber über das Stück:
„Er nahm diese ganze gelehrte Nahrung zu sich, erweiterte seine theoretische Erfahrung, doch je mehr er aus seinen Büchern erfuhr, desto weniger begriff er die reale konkrete Bedeutung der gewaltigen Lebenswelt, mit ihrer endlosen Vergangenheit und ihrer weitreichenden Gegenwart.“
Im Text, aus dem dieses Zitat stammt (Versuch über Hamlet), findet sich viel der modernen und zeitgenössischen Sprach- und Wissenschaftsskepsis. Als schlüge sich um 1900 der Positivismus endgültig auf die Seite der Maschinen, und die Menschen als Maschinenbauer bleiben ratlos dahinter zurück. Einige wenige von ihnen werden wie Hamlet zu Enzyklopädisten. Und einer davon begegnet uns 30 Jahre später in Sartres “Der Ekel“ wieder.
Noch interessanter aber fand ich die Wendung „endlose Vergangenheit“. Endlos heißt auch: unüberschaubar, nicht auszuloten. der Endlosigkeit ist kein technisches Kraut gewachsen. Nur der Begriff Fortschritt versucht diesem Material einen Sinn einzublasen, tut dieses aber auf Basis einer Selektion: was nicht in sein Schema passt, ist dem Untergang anheimgegeben. Aber wenn uns die endlose Vergangenheit nicht einschüchtert, setzt sie uns frei. (kann sie uns frei setzen.) Geschichte. Hat Geschichte, wenn sie keinen Anfang hat, dennoch ein ende? Schestow spricht von „endloser Vergangenheit und weitreichender Gegenwart“. kein Wort von Zukunft. als schüfe Geschichte sich im vergangenen Jahrhundert sich selber ab. Wer aber sind wir dann? Die Hinterbliebenen?
Der Zeitgenosse
Das Buch Siege und Niederlagen wird durch ein Reihe Philosophischer Fragmente beschlossen. Einige davon führen Gedanken an, beginnen mit deren Entwicklung, andere verhalten sich eher aphoristisch. Ein Lesevergnügen bergen sie alle. Das Fragmentarische scheint mir ein genuiner Ausdruck von Schestows Denkens zu sein, dabei lässt er die Romantik allerdings hinter sich, man könnte sagen: im Orkus verschwinden. Das Rätsel ist hier kein Zauber und auch kein Unvermögen des Erkennens, sondern strukturelles Moment und Resultat der Weltzuwendung. Unter den Fragmenten findet sich auf 330 Folgendes:
Die moderne wissenschaftliche Philosophie hat sich von den Mythen losgesagt, um so häufiger muss sie Zuflucht zu Metaphern nehmen, doch was ist eine Metapher anderes, als ein kostümierter Mythos? Kostümiert mit Alltagskleidung.
Diese Sätze sind erstaunlich, stellen sie Schestow doch als poststrukturalistischen Zeitgenossen dar. Allerdings ist mit dergleichem Label dem Autor nicht beizukommen. Wir werden an anderer Stelle an Schestows Rettung der Ratio zurückkommen. Aber das ist ein philosophisches Problem, das mir eine andere Disziplin abverlangt, als dieses Flanieren durchs Schestows, dass ich an dieser Stelle unternehme und durch das ich gewissermaßen erst einmal Geruch aufnehme.
Selten habe ich kompromisslosere und auf eine gewisse Weise respektlosere Art über Dostojewski gelesen wie bei Schestow, Dostojewski, der nicht nur in Russland, sondern gerade auch in Nordamerika eine Ikone ist. Er stellt ihn in einen narzisstisch-politischen Kontext, wie wir es heute nur von der Selbstbeleuchtung eines Günter Grass kennen. Und er nimmt damit etwas von dem vorweg, wie ein Schriftsteller durch den medialen Diskurs der Öffentlichkeit geistert:
Mit Begeisterung greift er die Idee der Eigenständigkeit auf. Tatsächlich sollte man die Tataren, sagt er, aus politischen, staatlichen und anderen derartigen Erwägungen (ich weiß nicht, was es mit den ›anderen‹ auf sich hat, doch wenn ich von Dostojewski Worte wie ›staatlich‹, ›politisch‹ u. dgl. höre, kann ich nur noch ungehemmt kichern) unbedingt hinausdrängen und auf ihrem Grund und Boden Russen ansiedeln. … Aus diesen lachhaften und hoffnungslos widersprüchlichen Behauptungen läßt sich nur eins herausspüren: Dostojewski hat von Politik keine, aber wirklich keine Ahnung, er versteht nicht das geringste davon, und außerdem hat er mit Politik auch gar nichts am Hut.
Diese Passagen stammen aus dem Essay über Fjodor Dostojewski, dessen Titel mich in eine ganz andere Richtung fürchten ließ. Nachdem Schestow also in Dostojewski – Prophetengabe den Autoren in der Talkshow hat beobachten können, und ihn verabschiedet hat als Ratgeber in Sachen Politik, finden wir ihn jetzt (Dostojewski aber auch den Autor selbst) im Zwiegespräch mit Hegel, Kant oder besser mit der Vernunft und der Vernunftphilosophie, an deren Grenzen die Erfahrung uns immer wieder führt. Von beiden Seiten übrigens. Schestow zeigt, wie Dostojewski der Hegelschen Philosophie misstraut, wie Kierkegaard sich ihr entwindet.
Unsere Vernunft strebe, sagt Kant, begierig nach dem Allgemeinen und Notwendigen, Dostojewski wiederum, inspiriert von der Schrift, verwendet all seine Kräfte darauf, sich der Macht des Wissens zu entwinden. Verzweifelt bekämpft er, wie Kierkegaard, spekulative Wahrheit und menschliche Dialektik, für die „Offenbarung“ bloße Erkenntnis ist. Wenn Hegel von „Liebe“ spricht – und Hegel spricht von „Liebe“ nicht weniger als von Einheit der göttlichen und menschlichen Natur –, sieht Dostojewski darin einen Verrat: Verraten werde das göttliche Wort. „Ich behaupte,“ so schreibt er in seinen letzten Lebensjahren im „Tagebuch eines Schriftstellers“, “dass das Bewusstsein des eigenen vollkommenen Unvermögens, der leidenden Menschheit zu helfen oder ihr zumindest irgendwie nützlich zu sein – und dies bei gleichzeitiger vollkommener Einsicht in ihre Leiden –, in unserem Herzen die Liebe zur Menschheit sogar in Hass verwandeln kann.
Markige Worte an der Schwelle zum 20. Jahrhundert. Aber die Geschichte ließ auf das philosophisch zumindest in Kontinentaleuropa durch Vernunftsglauben und Hegelianismus dominierte 19. Jahrhundert das 20. folgen. in dem sich die industriell entfalteten produktiven Kräfte in die zerstörerischsten verwandelten, die die Erde bis dahin kannte. Darüber hinaus ist die hier zitierte Arbeit Schestows eine zwingende Einführung der Existenzphilosophie:
Wie bei Belinskij wird also auch hier Rechenschaft gefordert für jedes einzelne Opfer des Zufalls in der Geschichte, d.h. für etwas, das in seiner Ereignishaftigkeit und Endlichkeit in der spekulativen Philosophie prinzipiell keine Bedeutung erhält, für etwas, dem niemand in der Welt – das weiß die spekulative Philosophie mit Bestimmtheit – abzuhelfen vermag.
Und da sind wir auf Freiheit noch gar nicht zu sprechen gekommen.
Schestows Freiheit
Aber wir müssen auf Freiheit zu sprechen kommen, wenn wir uns einem Autor wie Schestow zuwenden. Und zwar in doppelter Hinsicht: Einerseits scheint es mir noch immer Aufgabe des Denkens zu sein, die Antinomie zu überwinden, nach der Freiheit zwar möglich ist, der Zwang aber allgegenwärtig, und wir werden unser eigenes Freiheitskonzept befragen müssen, das eine Garantie beinhaltet, eine räumliche Begrenzung im Grunde nach dem Vorbild einer Gefängniszelle.
Unsere Freiheit wird garantiert und abgesichert durch Vefassungsparagraphen und Gesetze, und das ist gut so; im Grunde aber wird sie dadurch erst hervorgebracht, ist also ein Reflex auf Unfreiheit. Denn nichts anderes machen Paragraphen, als die Freiheit zu beschneiden oder eben ein Gatter zu errichten, in welchem sie gilt. Mag sein, dass das etwas drastisch formuliert und das Gatter notwendig ist, um mir, also dem einzelnen seine (klägliche?) Restfreiheit zu sichern. Ein Beigeschmack bleibt immer.
Unsere Freiheitskonzepte sind im Grunde Ergebnis der klassischen spekulativen Philosophie und Ausflüsse Hegelscher Dialektik. Sie sind vernünftig, jeder versteht sie (um an dieser Stelle Brechts Lob des Kommunismus ein wenig abzuwandeln.) Und sie sind im Ursprung Religiöse Konzepte.
Das letzte Kapitel von Schestows Buch Athen und Jerusalem. Versuch einer religiösen Philosophie. enthält unter prägnanten Zwischenüberschriften wie wir es etwa von Adornos Minima Moralia her kennen, eine Reihe Kurzessays. Unter dem Titel Spekulation schreibt Schestow:
… Darum beginnen alle spekulativen Systeme bei der Freiheit und enden bei der Notwendigkeit, wobei sie, da ja die Notwendigkeit allgemein gesprochen keinen guten Ruf genießt, gewöhnlich zu beweisen bemüht sind, dass jene letzte höchste Notwendigkeit, zu der man vermittelst der Spekulation gelangt, sich in nichts von der Freiheit unterscheide, mit anderen Worten, dass vernünftige Freiheit und Notwendigkeit ein und das selbe sei.
Schestow bläst also hier im Posaunenchor mit Nietzsche und Kierkegaard zum Angriff auf Kant und Hegel. Und es ist eine Freude, diesem Konzert zuzuhören, auch wenn man sich der Gefahr bewusst ist, die mit den Tönen mitklingt. Denn was sich so verlockend nach Emanzipation anhört, öffnet auch eine Tür in den Totalitarismus. Schestow allerdings war schon aus persönlicher Verfolgungsgeschichte, als Jude und russischer Emigrant, wenig geneigt, diesen Weg zu gehen.
Lektüren ziehen Lektüren nach an. Diesen für einen solchen Text eher untypischen Freiheitsexkurs habe ich einem Text Schestows über Ibsen zu verdanken. Ibsen ist mir selbst einer der liebsten Dramatiker, schon in der Schule hat mich die Nora ungeheuer beeindruckt, und vor ein paar Jahren befand ich mich im Theaterhimmel, als ich eine Inszenierung des Baumeister Solneß sah. In beiden Stücken werden Freiheit und Ausbruch aus bürgerlicher Enge verhandelt, aber ganz anders, als im folgenden:
Im titelgebenden Essay des Bandes Siege und Niederlagen stellt Schestow Ibsens prophetisches Versdrama Brand vor. Es war ein Text Ibsens, den ich nicht kannte, und den er vor seinen großen Emanzipationsdramen schrieb. Zum Glück war in einer Übersetzung von Christian Morgenstern zum kostenlosen Download im Netz zu finden, so dass ich die Lektüren Parallel fortsetzen konnte.
Das Stück mag Schestow sehr nahe gegangen sein, da es jenen Punkt szenisch sichtbar macht, an dem er selbst steht und arbeitet. Er beschreibt die Schnittstelle zwischen Vernunft und Religion. Zwischen Prophetie und falscher Prophetie.
Brand (ein suchender, aber religiös schon fanatisiert, trifft auf seinem Aufstieg ins Hochgebirge (zu Gott?) ein paar, dass sich auf dem Weg hinab (in die Zivilisation) befindet. Und dieser Moment des Zusammentreffens scheint das zu sein, was Schestow erheblich interessiert.
Der falsche Prophet, auch wenn er dem echten Propheten in jeder anderen Beziehung ähnlich wäre, traut sich selbst nicht und kann also auch nicht wissen, wohin er gehen soll. Er wird ewig schwanken, ewig seine Entscheidungen ändern: all seine seelischen Kräfte verausgabt er für den Kampf mit sich selbst, sodass für die Hauptsache nichts mehr übrig bleibt.
Was hier einen fundamentalistischen Anklang hat, ist im Grunde das Gegenteil von Fundamentalismus, denn wer sich seiner Sache sicher ist, benötigt keine Gewalt. Und wer sich seiner Sache nicht sicher ist, wie wir wohl alle, sollte sich vor Prophetie hüten. Auch hier findet sich etwas von Schestows Aktualität angesichts der sich gebärdenden neoliberalen und neoreligiös-fundamentalistischen Positionen.
***
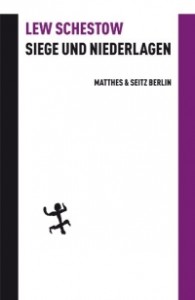 Siege und Niederlagen, von Lew Schestow
Siege und Niederlagen, von Lew Schestow
Übersetzt und herausgegeben und mit einem Vorwort versehen von Felix Fillipp Ingold
Matthes & Seitz 2013