Dies Leuchten. Dieses Leuchten, das keiner begreift, das alle herabzieht – nein, umgekehrt: auf die Höhe der Träume herab. Niemand, der weiß, wie dieses kalte Leuchten einen Anschein von Wärme erzeugt. Keiner kann das erklären. Das Übermeerische. Die leuchtenden Meerblauen Aras hat man getötet und nahezu ausgerottet, um hinter das Geheimnis des Farbenspiels zu kommen; selbst die hyazinthfarbigen und schmutzigblauen, ja, die Spix- und Lear-Aras, hat man bis auf hoffnungslose Restbestände dezimiert. Keiner der Schlächter hat je das Geheimnis ergründet. Nun stehen wir vor den Bälgen mit ihrem zur größeren Hälfte erloschenen Glanz. Das ist der Glanz des Geheimnisses, der in den toten Häuten noch steckt – und unauflösbar. Die andere Hälfte ist das Abbild, das Leben, der Duft der See, seltsam, gewissermaßen unauslöschlich, nicht wiederherstellbar, aus ihnen verschwunden. Es bleibt: der Schimmer des Meers, das keiner dieser Vögel auch nur einmal erblickt hat. Nur Geschrei und Felsenrot unter dem grünen, sich gegen den Boden streckenden Blättermeer. Gegenüber, von den anderen Ufern und Bäumen, an den Lehmlecken, das Kreischen der Arakangas. Darüber, im Azur – nicht Ultramarin – die eherne, ruchlose, gewalttätige und unabstellbare Brandung der Sonne, in der Dünung eines sich zunehmend ins Schwarze drehenden Himmels. Darüber das All in seiner vollkommenen Schwärze. Darunter allerdings, nun doch, die Ahnung des Meers, in Gedanken und Gefieder gefangen, in den seltenen Erden des Glücks. Das Glück ist notwendig, um ein Leben zu führen, heißt es, um über das Leuchten nachdenken zu können. Sekundenweise, tröpfchenweise (wenn noch ein Gran Leuchten in einem ist: Leuchten, das keiner begreift) und in den Käfigen der Köpfe die letzten Meerblauen und Spix- und Hyazintharas rucken, mit lebendigen Augen, an die wir uns klammern, weil die Federfarben uns Hoffnung lehren. Über diesem Abyss, an dessen Ränder wir unsere Häuser setzen im Glauben, daß die Tiefen sich einmal wieder füllen mit Meer; mit dem ultramarinen Glanz, nach dem uns ist und der in der irdenen Tiefe, in den seltenen Erden der Träume eines unfaßlichen Gottwesens (das wir nicht kennen, von dem wir unausgesetzt, den Blick auf die Vögel gerichtet, aber sprechen), das da wohl heißt: der große und unaussprechliche und unbegreifliche, leuchtende Ultramarin. Und ihn, den Gott, erst begreifen, wenn die Kometenschauer, längst aus der Schwärze gelöst, sich auf uns zu bewegen, eine lodernde Gischt aus Eis und Feuer und Fäulnisgeruch, ein in sich kochender Widerspruch der Vernichtung. Und ihn erst begreifen, wenn der große Unbegreifliche sich löst, und, dem Blick entgleitend, nach einem neuen Domizil Ausschau hält, während in den Volieren die schimmernden Papageien, die letzten ihrer jeweiligen Art, zwischen den Bälgen ihrer ausgestorbenen Kameraden kreischend verbrennen – das Gefieder eine Myriade von Fackeln, sich spiegelnd im Nachglanz des fortgegangenen Gottes, von dem wir erst seit kurzem wissen. Ja, der wirkliche Gott, das unerreichbare Ziel unserer Sehnsucht; getaucht in einen geträumten Gedankenglast aus Vogelgeschrei, aus dem wir unsere Nenn-Aras hören, beträuft von der Idee eines nurmehr erdachten, herbeizitierten, letzten Stäubchens Ultramarin. Das sich auflöst und in die zunehmende Schwärze verzieht, den dunkelnden Glast, der unsere Geheinmissucht ist … von den Schweifen der Kometen, dem Grunzen der Meteoritenschauer zerspellt und versengt: Blau, mit Schwärze bereift. Es bleibt: der Schimmer des Meers, gespiegelt im Azur des Luftozeans über den Bäumen. Niemand kann das erklären. Keiner hat je das Geheimnis ergründet.
***
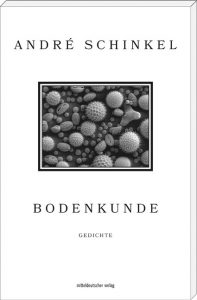 Weiterführend → Lesen Sie auch das KUNO-Porträt des Lyrikers André Schinkel.
Weiterführend → Lesen Sie auch das KUNO-Porträt des Lyrikers André Schinkel.
→ Poesie zählt für KUNO weiterhin zu den identitäts- und identifikationstiftenden Elementen einer Kultur, dies bezeugte auch der Versuch einer poetologischen Positionsbestimmung.