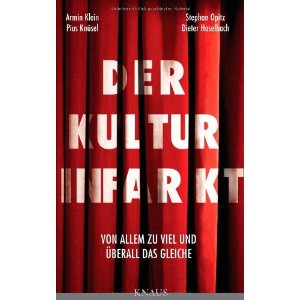 Der Spiegel hält sich nicht mehr an VÖ-Termine, hatte mal wieder ein Woche vorgezogen und druckte eine Streitschrift der Kulturmanagern Dieter Haselbach, Armin Klein, Pius Knüsel und Stephan Opitz, deren Buch „Der Kulturinfarkt“ heute erscheint. Darin wird behauptet, „Kultur für alle“ sei eine Illusion aus den 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts, die sich erledigt habe. Die Hälfte aller staatlich geförderten Theater, Museen oder Bibliotheken in Deutschland könne geschlossen werden. Das behaupten die ausgewiesenen Experten, sie sind davon überzeugt, dass die Forderung „Kultur für alle“ gescheitert sei. Das kulturelle Angebot wachse ständig, die Zahl der Konsumenten dagegen nicht. Die Autoren folgern daraus, dass man künftig auf die Hälfte der subventionierten Institutionen verzichten könne. Das System werde dann besser funktionieren. Die frei werdenden Mittel müßten neu verteilt werden. Das Ziel der Autoren ist es, den Staat aus der Verantwortung für die „ästhetische Erziehung des Menschengeschlechts“ (Friedrich von Schiller) zu entlassen. Kulturpolitik sei heute „ein anonymer Auftrag an viele zur normativen Anpassung an wenige“. In Zukunft müsse sie dafür sorgen, dass es nur „Regeln“ geben solle, „in denen die Menschen, frei und ihrer selbst mächtig, sich entfalten“ können.
Es gibt zu viel subventionierte Kultur bei ständig schrumpfendem Publikum, diagnostizieren sie und fordern eine Orientierung am Markt:
Der Spiegel hält sich nicht mehr an VÖ-Termine, hatte mal wieder ein Woche vorgezogen und druckte eine Streitschrift der Kulturmanagern Dieter Haselbach, Armin Klein, Pius Knüsel und Stephan Opitz, deren Buch „Der Kulturinfarkt“ heute erscheint. Darin wird behauptet, „Kultur für alle“ sei eine Illusion aus den 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts, die sich erledigt habe. Die Hälfte aller staatlich geförderten Theater, Museen oder Bibliotheken in Deutschland könne geschlossen werden. Das behaupten die ausgewiesenen Experten, sie sind davon überzeugt, dass die Forderung „Kultur für alle“ gescheitert sei. Das kulturelle Angebot wachse ständig, die Zahl der Konsumenten dagegen nicht. Die Autoren folgern daraus, dass man künftig auf die Hälfte der subventionierten Institutionen verzichten könne. Das System werde dann besser funktionieren. Die frei werdenden Mittel müßten neu verteilt werden. Das Ziel der Autoren ist es, den Staat aus der Verantwortung für die „ästhetische Erziehung des Menschengeschlechts“ (Friedrich von Schiller) zu entlassen. Kulturpolitik sei heute „ein anonymer Auftrag an viele zur normativen Anpassung an wenige“. In Zukunft müsse sie dafür sorgen, dass es nur „Regeln“ geben solle, „in denen die Menschen, frei und ihrer selbst mächtig, sich entfalten“ können.
Es gibt zu viel subventionierte Kultur bei ständig schrumpfendem Publikum, diagnostizieren sie und fordern eine Orientierung am Markt:
„Misserfolge wie Erfolge im Markt müssen sich für Kultureinrichtungen auswirken, neben aller Subvention. Dass Kultureinrichtungen im Markt erfolgreich agieren können, setzt voraus, dass der Markt nicht mit geförderten Institutionen überbesetzt ist, die sich gegenseitig das Publikum abjagen und sich im Wettrennen um Förderung überbieten.“
Das kulturpolitische Programm einer »Kultur für alle« war Höhepunkt der bürgerlichen Bildungsutopie, die tief in der deutschen Klassik wurzelte: Es ging um nichts weniger als die „ästhetische Erziehung des Menschengeschlechts“; darunter machen es die Deutschen nicht. Doch längst können Kunst und Kultur weder das individuelle noch das kollektive Glücksversprechen erfüllen. Sie ermöglichen weder die Vervollkommnung des Einzelnen noch erlösen sie von den Zumutungen der Globalisierung und Moderne. Sie stiften weder den Zusammenhalt der Nation noch helfen sie bei der Integration des Fremden. Sie befördern nicht die Wirtlichkeit unserer Städte und schon gar nicht das ökonomische Wachstum durch eine blühenden Kreativwirtschaft. Vielmehr spaltet öffentlich geförderte Kultur die Gesellschaft. Der Fetisch Kulturstaat, in dem alle diese Wunschvorstellungen kulminieren, stößt an seine Grenzen. Wer einen Diskurs über die Ziele öffentlicher Kulturausgaben möchte, trifft auf eine harte Kulturlobby: Gegen Kultur darf niemand sein und alles, was ist, muss bleiben. Denn das oberste Ziel öffentlicher Kultureinrichtungen ist nicht etwa Kunst oder Innovation, sondern der schiere Selbsterhalt.
Eines haben die Kulturmanager vergessen, als sie diese Streitschrift gegen die Subventionskultur geschrieben haben: Sie sind selbst Teil des Problems. Ihre Forderung die Kunstproduktion habe sich einem „Wirklichkeitstest“ zu unterziehen wirft verborgene Ratlosigkeiten auf: Wie sähe der aus? Muss ein Laie beschreiben können, welches wirklich existierende Ding das Kunstwerk darstellt? Dürfte nur noch Kunst gefördert werden, die ein Minimum an Ausstellungsbesuchern anzieht – und was, wenn dieser Ausstellungserfolg das Verdienst der Ausstellungswerbung war? Und wie bestimmt man das, was der hölzern um Lässigkeit ringende Bürokratenjargon der Autoren als „Klasse“ eines Kunstorts apostrophiert?
Dabei ist die Stoßrichting nicht falsch. Daß die üppigen Subventionen für Theater, Opern und Museen ausnahmslos zu kulturellen Höchstleistungen führten wird niemand, der auch nur annähernd bei Verstand ist behaupten. Die Autoren des „Kulturinfarkt“-Buches haben den Finger auf eine Wunde gelegt müssen. Problematisch am vom Staat geförderten und mit gutem Grund von diesem inhaltlich nicht gesteuerten Kulturbetrieb findet ich aber in erster Linie den Filz in den Jurys, Kommissionen, Räten und dergleichen.
Die Konzentration im Kulturbetrieb schreitet im Internetzeialter rasant voran. Kunst ist eine Ware mit besonderer Aura. Über ihre Vermarktungsstrategien streitet man sich bereits, seit Gutenbergs Erfindung des Bleisatzes. Der Markt für anspruchsvolle Innovationen und Entdeckungen hat sich dramatisch ausgedünnt, die Neugier auf Kunst hat in einem beängstigenden Maß nachgelassen. Pop, Glamour und Spaßkultur haben sich vor das Ernstere geschoben. Zerstreuung, Abenteuer, Selbsterfahrung, Internet verbauen den Blick auf das Wesentliche, das wir benötigen, wenn viele dieser Phänomene ihre Anziehungskraft verloren haben. Buchhändler verlangen Werbekostenzuschüsse, damit Bücher überhaupt in der Auslage präsentiert werden, die Presse ist immer stärker von den Anzeigen der Großverlage abhängig, deren Bücher sich immer ähnlicher werden und die Literaturkritik ist auf den Hund gekommen. Umgeschriebene Waschzettel beleidigen die Leser genauso wie redaktionelle Inhalte, die an Anzeigen geknüpft sind. Warum solche Bücher wie die von Joanne Rowling, Henning Mankell oder Stephen King zum Bestseller werden, mag leicht zu erklären sein. Originalität jedenfalls spielt keine Rolle.
Es wird zu viel Vermeidungsfiktion geschrieben. Über die schmerzlichen Wunder unserer Existenz erfährt man bei Holger Benkel, Peter Meilchen, oder A.J. Weigoni ungleich mehr als beim Eintauchen in die mürbe Welt eines Wilhelm Genazino, Botho Strauss oder Martin Walser, von all den jungen bis mittelalten Autoren und Autorinnen ganz zu schweigen, deren Helden sämtlich Jonas oder Anna heißen und in Prenzlberger Cafés ihre Zeit absitzen. Dostojewski behauptete, der Kummer schaffe die Poesie, Kunst sei die heilige Frucht des Leids. Dieses Leid zu ertragen, sei die Pflicht des Künstlers.
***
Der Kulturinfarkt. Von Allem zu viel und überall das Gleiche. Eine Polemik über Kulturpolitik, Kulturstaat, Kultursubvention. Erscheint heute bei Knaus.
