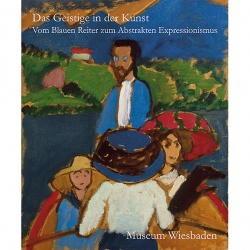In drei theoretischen Werken hat Kandinsky sich über das Wesen seiner Kunst ausgesprochen: Allgemein und im kulturellen Sinne in dem mit Franz Marc herausgegebenen »Blauen Reiter«, über die Formfrage speziell in »Das Geistige in der Kunst«, über die malerische Frage in seiner Selbstbiographie, dem im Sturm-Verlage erschienenen Kandinsky-Album.
Im »Blauen Reiter« und in »Das Geistige in der Kunst« hat Kandinsky sein Formproblem stark abgegrenzt sowohl gegen den Expressionismus, wie gegen den Kubismus und Futurismus. Expressionismus und Futurismus sind ihm Richtungen, die nur eine stärkere ideelle Verarbeitung des Sinneneindrucks anstreben. Das Resultat ist hier eine Verflachung im Äußerlichen (anstelle von Landschaften, Caféhäusern, Interieurs, die der Impressionismus brachte, sind Autos, Flugmaschinen, Glühbirnen etc. getreten.) Dort eine etwas rüde Phantastik, die den Gegenstand und seine Materialität nicht ablehnt, sondern ihn transformiert und oftmals seine Materialität noch unterstreicht. Auch im Kubismus sieht Kandinsky nur eine Übergangsform. »Der Kubismus zeigt, wie oft die naturellen Formen den konstruktiven Zwecken gewaltsam untergeordnet werden müssen und welche unnötigen Hindernisse diese Formen in solchen Fällen bilden.« Der Kubismus, der einen Kontrapunkt der Form befürwortet, ein Dogma der einfachen geometrischen Formen (Dreieck, Kreis, Rhombus etc.), angewandt auf den Gegenstand, scheint ihm den symphonischen Reichtum der Zeit nicht umfassend genug wiederzugeben, scheint ihm an einer absichtlichen Selbstbeschränkung (Picassos Askese) zu kranken. Der klar daliegenden, oft in die Augen springenden »geometrischen Konstruktion« stellt er die an Möglichkeiten reichste, ausdrucksvollste, »versteckte« rembrandtsche freie Konstruktion gegenüber. Wenn man den Kubismus seiner schroffen, fast preußischen Zentralisation und Ordnung wegen heute in Paris eine »Boche-Kunst« schimpfen hört, so ist eines sicher, daß Kandinsky als einer der ersten sich gegen die allzu strenge Organisation des Kubismus, der moralische Werte an die Stelle von ästhetischen setzt, verwahrte. Auf das Zahlenverhältnis als Konstruktionsprinzip kommt auch Kandinsky. Aber wenn Zahlen der letzte Ausdruck ästhetischer Gesetze sind: warum muß die Zahl I heißen, nicht 0,33333; das heißt: warum die primitive Form statt der komplizierten? Schönheit ist eine Ordnung, die nicht auf den ersten und auch nicht auf den hundertsten Blick hin nachzurechnen ist. Schönheit ist ein Vielfaches der Ordnung, das nicht mehr übersehen werden kann. Der Kubismus arbeitet mit der Grammatik, Kandinsky mit der labilen, inneren Notwendigkeit. Seine Kunst zielt auf Entfesselung ab und fängt die Zeit mit all ihren Spitzen, Geheimnissen, Ausflüchten, mit all ihren Vorder-und Hintergründen, all ihrer Sophistik und all ihren harten und zärteren Gegensätzen und Widersprüchen in sich ein. Der Kubismus greift zu mit Zirkel und Winkel, er mißt, wiegt, schneidet, er ist hart und gewaltsam, unbeugsamer Richter und unbestechlicher Zeuge. Er straft und belohnt, er hat etwas von der spanischen Inquisition und der deutschen Prinzipien-Rechtwinklichkeit. Er unterdrückt das Detail, statt ihm Freiheit zu lassen. Er prussifiziert und purifiziert die Kunst. Er ist häßlich aus Prinzip, und gerade das muß für Kandinsky seine Schönheit sein. Und ist es auch.
Die Gefahren seiner eigenen Kunst sieht Kandinsky in zwei Bereichen: in der völlig abstrakten, ganz emanzipierten Anwendung der Farbe in geometrischer Form, dem Ornament, das aus nicht mehr sprechenden Allegorien und Hieroglyphen besteht, und in der Überbeseelung, dem Abgleiten der Form ins Märchenhafte, das den Beschauer starken seelischen Vibrationen entzieht, weil er, im Märchenlande nur noch das Spiel der Illusion, nicht mehr aber den Ernst empfindet. Zwischen diesen beiden Polen, deren Vermeidung an Intellekt und Intuition, an Vitalität und Begabung des abstrakten Künstlers die stärksten Anforderungen stellt, liegt Kandinskys Thema: »Kampf der Töne, das verlorene Gleichgewicht, fallende ›Prinzipien‹, unerwartete Trommelschläge, große Fragen, scheinbar zielloses Streben, scheinbar zerrissener Drang und Sehnsucht, zerschlagene Ketten und Bänder, die Mehrere zu Einem machen, Gegensätze und Widersprüche.«
Drei verschiedene Stufen von Bildausdrücken, nennt er, die zugleich drei verschieden intensiven Verarbeitungsformen der äußeren Natur gegenüber entsprechen: Impressionen, in denen ein direkter Eindruck von der äußeren Natur dargestellt wird; Improvisationen, die hauptsächlich unbewußte, plötzlich entstandene Ausdrücke inneren Charakters, Ausdrücke der inneren Natur sind; und Kompositionen, langsam und fast pedantisch nach ersten Entwürfen ausgearbeitete Symphonien innerer Farben- und Formerlebnisse.
Man sieht: das Verzichten auf das Gegenständliche ist ihm kein Dogma, sondern eine Intensitätsfrage. Mit welchem unerhörten Takt aber, mit welcher Empfindlichkeit für Gewichte und Gleichgewichte, mit welchem Equilibrierungstalent Kandinsky arbeitet, das ist die Stärke seiner Begabung. Hier ist das Gleichgewicht, die Waage das Wesen der Welt geworden. Nicht gerichtet wird, gestraft und belohnt, sondern ausgeglichen: dem Guten wird Böses gesellt, dem Bösen Gutes. Ruhe, Friede, Gleichheit besteht, Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit der Formen. In erster Linie aber grandiose Freiheit. Jede Form, die hinzudrängt, hat Platz, findet ihren Platz im Kosmos. Nichts wird unterdrückt. Alles darf blühen, schweben, dasein, mit Jubel, Schrei und Trompete.
Man hat Kandinsky in seinen Akademikerjahren boshaft einen Landschaftsmaler genannt, er ist es, wenn auch nicht im landläufigen Sinne. Er hat Landschaften gemalt, aber es waren die Landschaften der geistigen Verfassung des Europas von 1913 und mehr noch des über den Absolutismus hinaus aufbrechenden Rußland. Er hat diese Landschaften der geistigen Hintergründe mit glühender Buntheit in den Himmel einer neuen Zeit gemalt.
Kandinsky hat viel nachgedacht über eine Harmonielehre der Farben, über die Moralität und die Soziologie der Farben. Seine Resultate hat er im »Geistigen in der Kunst« tabellarisch und theoretisch mitgeteilt. Er gab eine literarisch interessante Psychologie der Farben im Anschluß an Delacroix, van Gogh und Sabanejeff, den Kritiker Skrjabins, der eine Tonleiter der Farben aufzustellen versuchte. Kandinsky kennt die sanitäre, die animalische und die motorische Kraft der Farbe, er sammelt Elemente zu einem Generalbaß der Malerei, aber sein letztes Wort ist kein Farbenkatechismus, keine verbindliche Harmonielehre, sondern immer nur das freiheitliche Prinzip der inneren Notwendigkeit, die der einzige Führer und Verführer bleibt. »Die ersten Farben, die einen starken Eindruck auf mich gemacht haben, waren hell saftig grün, weiß, karminrot, schwarz und ockergelb.« Wenn man weiß, was diese Farben für ihn bedeuten: »Grün ist im Farbenreich das, was im Menschenreich die sogenannte Bourgeoisie ist, es ist ein zufriedenes unbewegliches mit sich zufriedenes, nach allen Richtungen beschränktes Element. Weiß: wie ein Symbol einer Welt, wo alle Farben, als materielle Eigenschaften und Substanzen verschwunden sind. Diese Welt ist so hoch über uns, daß wir keinen Klang von dort hören können. Es kommt ein großes Schweigen von dort, welches wie eine unübersteigliche, unzerstörbare, ins Unendliche gehende kalte Mauer uns vorkommt. Rot: das helle warme Rot erweckt das Gefühl von Kraft, Energie, Streben, Entschlossenheit, Freude, Triumph, es erinnert musikalisch an den Klang der Fanfaren wobei die Tuba mitklingt.« – So weiß man auch, daß Kandinsky, der in Farben denkt, seine spätere Welt schon in der Kindheit fand, wenn sie ihm in ihrer Besonderheit auch noch nicht zu Bewußtsein kam. Haben seine Bilder also doch einen gegenständlichen psychologischen Sinn? Kaum. Seine Farbenpsychologie beweist nur die Schärfe und Empfindlichkeit, mit der er die Farbe prüft, ist nur ein Versuch, der letzten Geheimnisse jener »Inneren Notwendigkeit« habhaft zu werden, ein Anstürmen gegen die Grenzen seiner Kunst, keineswegs aber ein Wegweiser zu einer gegenständlichen Interpretation der Bilder.
Und am Schlusse der Selbstbiographie heißt es: »Meine Mutter ist eine geborene Moskowitin und vereint in sich die Eigenschaften, die für mich Moskau verkörpern: äußere, auffallende, durch und durch ernste und strenge Schönheit, feinrassige Einfachheit, unerschöpfliche Energie, eigenartig aus starker Nervosität, imponierender majestätischer Ruhe und heldenhafter Selbstbeherrschung geflochtene Vereinbarung von Tradition mit echtem Freigeist. Moskau: Die Doppellebigkeit, die Kompliziertheit, die höchste Beweglichkeit, das Zusammenstoßen und Durcheinander in der äußeren Erscheinung, die im letzten Grunde ein eigenes, einheitliches Gesicht bildet, dieselben Eigenschaften im inneren Leben. Dieses gesamte äußere und innere Moskau halte ich für den Ursprung meiner künstlerischen Bestrebungen.« Einen Sonnenuntergang über den Kuppeln und Türmen Moskaus bezeichnet er als den stärksten Eindruck seiner Jugend. Zwei überwältigende Kunsteindrücke bewahrt er von seinen russischen Studienjahren her: Eine Lohengrin-Aufführung am Moskauer Hoftheater und Rembrandt in der St. Petersburger Eremitage. Über Lohengrin schreibt er: »Die Geigen, die tiefen Baßtöne, und ganz besonders die Blasinstrumente verkörperten damals für mich die ganze Kraft der Vorabendstunde. Ich sah alle meine Farben im Geiste. Sie standen vor meinen Augen. Wilde, fast tolle Linien zeichneten sich vor mir. Ich traute mich nicht den Ausdruck zu gebrauchen, daß Wagner musikalisch ›meine‹ Stunde gemalt hatte. Ganz klar wurde mir aber, daß die Kunst im allgemeinen viel machtvoller ist als sie mir vorkam, daß andererseits die Malerei ebensolche Kräfte wie die Musik besitzt, entwickeln könnte. Und die Unmöglichkeit, selbst diese Kräfte zu entdecken, jedenfalls zu suchen, verbitterte noch mehr meine Entsagung.« Und über Rembrandt schreibt er: »Rembrandt hat mich tief erschüttert. Die große Teilung des Hell-Dunkel, die Verschmelzung der Sekundärtöne in die großen Teile, das Zusammenschmelzen dieser Töne in diese Teile, die als ein Riesendoppelklang auf jede Entfernung wirkten und mich sofort an die Trompeten Wagners erinnerten, offenbarte mir ganz neue Möglichkeiten, übermenschliche Kräfte der Farben an sich und ganz besonders die Steigerung der Kraft durch Zusammenstellungen, d.h. Gegensätze. Später verstand ich, daß diese Teilung ein der Malerei erst fremd und nicht zugänglich erscheinendes Element auf die Leinwand hinzaubert – die Zeit.«
Mit Rembrandt und Wagner bezeichnet Kandinsky zugleich die innere Form, die Zeit und Dimension seiner Bilder. Er teilt mit ihnen das evanghelisch-christliche, das parsifalische und pathetische Element. Er ist reiner als sie in der Spiritualität, geläuterter in den Komplexen, Horizonten und Instinkten. Am Urchristentum lobt er daß damals auch die Schwächsten teilnahmen am geistigen Kampf. Seine Bühnenkomposition ›der Gelbe Klang‹ klingt in ein großes aufgerichtetes Kreuz aus.
***
 Im Mai 1915 emigrierte Hugo Ball gemeinsam mit Emmy Hennings in die Schweiz, wo er zunächst in Zürich wohnte. Er tingelte mit einem Varieté-Ensemble als Klavierspieler und Texter durch das Land. Schließlich kam er in Kontakt mit der Tanzschule von Rudolf von Laban, die als Treffpunkt der Dadaismusbewegung galt. Im Februar 1916 gründete er mit Hans Arp, Tristan Tzara und Marcel Janco in Zürich das Cabaret Voltaire, die als „Wiege des Dadaismus” bezeichnet wird.
Im Mai 1915 emigrierte Hugo Ball gemeinsam mit Emmy Hennings in die Schweiz, wo er zunächst in Zürich wohnte. Er tingelte mit einem Varieté-Ensemble als Klavierspieler und Texter durch das Land. Schließlich kam er in Kontakt mit der Tanzschule von Rudolf von Laban, die als Treffpunkt der Dadaismusbewegung galt. Im Februar 1916 gründete er mit Hans Arp, Tristan Tzara und Marcel Janco in Zürich das Cabaret Voltaire, die als „Wiege des Dadaismus” bezeichnet wird.
Weiterführend →
Lesen Sie auch einen Artikel über die Gründung des Cabaret Voltaire.
→ Zum Thema Künstlerbucher finden Sie hier einen Essay sowie ein Artikel von J.C. Albers. Vertiefend auch das Kollegengespräch mit Haimo Hieronymus über Material, Medium und Faszination des Werkstoffs Papier.
Die bibliophilen Kostbarkeiten sind erhältlich über die Werkstattgalerie Der Bogen, Tel. 0173 7276421