Daniel sitzt am PC und spielt. Er kann nicht schreiben. Dieses verdammte Theaterstück zu Ende führen. Ein bleiernes Netz ist seine Besessenheit davon – es stranguliert langsam sein Gehirn.
Er hat es fünf Mal umgeschrieben, ist immer noch unzufrieden.
Die Dramaturgie sackt in sich zusammen, ohne den Sprung in die Metapher zu schaffen. Sie führt die Charaktere in künstliche Situationen, sie landen dort in einer Sackgasse, zergehen in schlammiger Unglaubwürdigkeit. Die Dialoge klingen aufgestellt, es gibt keine Anklage, keine Kraft.
Er hat keine Kraft mehr, das ist die Erkenntnis, die ihm dieses wiederholte Scheitern aufzwingen will.
Er kann nichts mehr, außer über sich selbst und die falsch angelegten Gleise des eigenen Schicksals schreiben. Nabelschau. Das ist es, was er betreibt und sich dabei selbst anekelt. Die blutige Schnur hängt an seinem Bauchnabel, diese erwürgte Schlange, die über sein Glied und seine Oberschenkel schlägt und ihn daran erinnert, dass er starb, ehe er zu leben begann. Ein gutes Stück vor sechs Jahren und seitdem Sense, Schluss, Exit.
Eine Folge des Erfolgs, der damaligen verschwenderischen Eucharistie des Selbst – diese Kraftlosigkeit. Das Ich – zerlegt an Nebenschauplätzen. Mal hierhin, mal dorthin geschleppt, in Literaturbüros und Ausschüsse, auf Buchmessen oder Einweihungen. Verwickelt in lächerliche Machtkriege, gezerrt auf fremde Schlachtfelder.
Daniel steht auf, geht auf Zehenspitzen ins Schlafzimmer und setzt sich auf die Bettkante.
Er betrachtet den Schlafenden für eine Weile. Möchte ihn nicht wecken. David liegt auf dem Bauch, die Decke faltet sich unter den Achselhöhlen zusammen, lässt Schultern und Arme frei. Über sie fließt das graue Licht dieses trostlosen Vormittags, versickert in dem Grübchen des Nackens.
Daniel legt die Hand auf Davids Nacken und spreizt die Finger weit auseinander. Er fächert sie vorsichtig vom Ohrläppchen bis zum Schlüsselbein in einer runden Bewegung über den Halsmuskel. Er zieht sie um diese kurvende, fleischliche Mulde langsam zusammen. In der Höhlung seiner Handfläche spürt er Davids Blut durch die Halsader wallen und gegen die Haut schlagen.
David zuckt im Schlaf, stöhnt und dreht sich auf den Rücken. Er legt den linken Arm über die Augen und wendet sein Gesicht von Daniel ab.
„Er ist mir entglitten“, denkt Daniel und legt die Hand auf die Decke, neben Davids Hüfte. Er weiß nicht mehr, was David für ihn empfindet. David ist der einzige, mit dem er kommunizieren kann. Konnte… David stellt die richtigen Fragen, beschwört die richtigen Assoziationen herauf, weist auf die richtigen Zusammenhänge hin. David ist streng. Unnachgiebig. Duldet keine Entgleisung, bringt ihn immer wieder auf seinen Weg zurück.
Er entgleist trotzdem, sobald er allein bleibt.
Daniels Blick spielt das Licht-und-Schatten Spiel, schießt auf die Decke von Lichtpfütze zu Lichtpfütze, landet auf trockenem Schattenboden. Dort sinkt die weiche Oberfläche des Stoffs in die Täler des liegenden Körpers, folgt dem Relief des Fleisches. Des vollkommen schönen Fleisches. Auf und ab, Mulden und Vertiefungen. Vollkommen schön ist Davids Fleisch. Das kommt hinzu. Diese Schönheit, die schmerzt. Der Mund, der Hals, die Schultern. Die schlanken Hüften und die betörend schmeckende Haut dazwischen. Sein Glied. Sein perfekt gemeißelter Schwanz. Mit den beinahe unsichtbaren Wülstchen der Venen und den stillen Gezeiten, die sie anschwellen lassen und darin pulsieren. Davids Schwanz, den er seit Monaten nicht mehr gespürt hat.
Nein, seit drei Wochen. Es kommt ihm nur vor, als seien Monate vergangen. Der Arzt meinte, die Pillen würden den sexuellen Appetit mindern. Nicht die Spur. Er träumt jede Nacht davon. Seine Träume sind abstrus, voller Gewalt und Scham. Er wacht schweißgebadet auf. Vielleicht liegt es an seiner Lektüre.
Er liest gerade de Sades Die Hundertzwanzig Tage von Sodom.
Daniel verlässt das Schlafzimmer, geht ins Arbeitszimmer zurück. Er setzt die Kopfhörer auf und legt eine CD ein: Rameaus Stücke für Harpsichord. Die Akkorde lassen sein Zwerchfell erzittern. Woher die Kraft für diese intensive Freude? Die vergeistigten Ausschweifungen des Barocks, die vor Sinnlichkeit bersten. Die fröhliche Hastigkeit selbstsüchtiger Lawinen. Man stellt sich ihnen in Demut, glücklich darunter ersticken zu dürfen.
Daniel öffnet seine Tagebuchdatei und schreibt:
„De Sade findet für seine intelligent begründete Menschenverachtung ein formelles Gerüst von Erzählregeln und Grundsätzen der Anekdote, das diese erträglich macht, sie sogar unterhaltsam verpackt. Wodurch? Er folgt gerade jener Gesetzlichkeit der Übertreibung in der Anekdote, die bei Achtung der herkömmlichen Erzählregeln die Verachtung selbst erweckt. Mutig! Wären seine Charaktere nicht so abscheulich verdorben, blieben die theoretischen quod erat demonstrandi bloß Ausdruck misanthropischen Sinnierens. Niemand würde die moralische Stärke haben, seine sarkastischen Abhandlungen über die Verdorbenheit der menschlichen Schöpfung und die Unzuverlässigkeit der göttlichen zu lesen, dürfte er nicht gleichzeitig sich darüber empören.
Es ist nicht anders bei Petronius oder Swift.
Die Katharsis wird durch die Radikalität der Sicht, der Sprache oder der Anekdote erzeugt. Weil aber die Anekdote immer ihre eigene theoretische Auslegung überdauert, wird die Theorie durch praktische Anwendung radikalisiert.
Nun macht das Maß den Unterschied. Nämlich wie weit man bereit ist, die Grenzen der Akzeptanz (oder Verständlichkeit) der Anekdote zu verschieben. Wie schwer zu überwältigen die dazu entworfenen Vorgehensweisen sind und in welchem Maße man sie letztendlich in die Schrift umzusetzen vermag.
Kein Schwein liest Finnegans Wake außer Literaturfreaks und Sprachwissenschaftlern. Was aber seinen Wert oder seinen Effekt auf die Literatur nicht mindert. Weil das, was man durch die Radikalität in der Kunst erreicht, genau so berechtigt signifikant wirken darf wie jede andere Form der Aussage und / oder Umsetzung. Die Fülle (theoretisch unerschöpflich) von Formen und / oder Anekdoten, die die wenigen signifikanten Inhalte und / oder Ideen der Menschheit transportieren, ist schlechthin unwiderlegbar. Und dann kommt die Frage – aus dieser Fülle, welche sind die meinigen? Was ist die Formel, anhand derer ich meine Form konstruieren kann?
Ist sie überhaupt eine bereits existierende Formel, die ich bloß entdecken soll, oder muss ich sie erst erfinden?“
Daniel trinkt einen Schluck Kaffee und schreibt weiter:
„Der Schlüssel ist der Text selbst.
Zu irgendeinem Zeitpunkt, innerhalb irgendeines Kommunika-tionsmusters wird er signifikant. Er ist Teil einer Gesamtheit, wird als solcher irgendwann wahrgenommen. Auch wenn die Gesamtheit nie wahrnehmbar werden kann, werden ihre Teile nach und nach wahrgenommen. So entsteht sie in der Wahrnehmung, die sie nicht erschöpfen kann.
Ein Text aber wird eines Tages unvermeidlich übersetzt werden. Darauf kann man sich verlassen. Sicher lauert darin die Gefahr des Missbrauchs. Wie bei de Sade, der als pornographischer Schriftsteller degradiert wird. Eine gewöhnliche Fehlleistung unbedarfter Leser: den Autor mit seinen Charakteren zu verwechseln. Aber nicht darum geht es letztendlich.
Es geht darum, dass man überdauert, weil man berechtigt frei ist. Auch vom Missbrauch. Dass man durch die Behauptung der eigenen Freiheit, die Berechtigung jener aller anderen anerkennt.
Es ist eine Frage des gegenseitigen Respekts zwischen Schreiber und Leser. Die Anekdote selbst braucht nichts zu verdinglichen. Wenn es ihr gelingt, eine einzige Saite in einem erklingen zu lassen, dann verdinglicht sie sich in sich selbst.
Dann ist sie vollkommen und frei…
Sie schaffen es alle, die Echten. Einen Schritt weiter in die Wüste des Nichtmenschlichen hinein zu wagen, um ihr ein Stück fremdartigen Terrains zu entreißen, es durch Sprache zu vermenschlichen und fruchtbar zu machen. Eine neue Sprache ist jedes Mal die Sublimierung der Nichtsprache anderer. Es gelingt ihnen, den Echten. Die Unartikulierbarkeit des Unartikulierten zu artikulieren, das Unfassbare fassbar zu machen. Joyce, Beckett. Was auch immer am Boden des Schmelztiegels bleibt, ob Sprache oder Nicht-Sprache, es sind immer die Zeichen, die Elementarteilchen der Kommunikation, die neu definiert werden. Wenn sie sich in einer radikal neuen Zusammensetzung befinden, lassen sie einen radikal neuen Kontext entstehen. Es ist so logisch, so einfach. Warum schaffe ich es nicht, jenseits der Theorie?“
– „Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht“, flüstert Daniel und sieht auf die Uhr. Die Dicke Bertha zeigt elf Uhr, vierundzwanzig Minuten und eine unbekannte Anzahl von Sekunden.
* * *
Am Todestag von Ioona Rauschan erinnert KUNO an diese Autorin mit einer Leseprobe aus: Abhauen. Dieser Roman erschien 2008 beim Pop Verlag, Ludwigsburg.
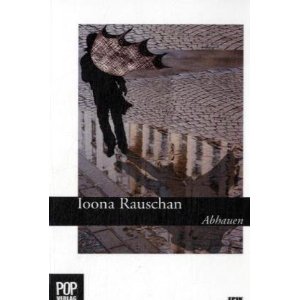
Auf der Schwelle. Ein Filmessay über Heinrich Heine von Ioona Rauschan. Edition Biograph, 1997
Die schöne Strickerin, Novelle von Ioona Rauschan, Edition Biograph, Düsseldorf 1995. (Antiquarisch erhältlich).
Weiterführend →
Ein Kollegengespräch mit Ioona Rauschan findet sich hier. Das Live-Hörspiel 5 oder die Elemente wurde in der Regie von Ioona Rauschan mit Marion Haberstroh und Kai Mönnich im Gutenberg-Museum zu Mainz uraufgeführt. Señora Nada, in der Regie von Ioona Rauschan, ist auf Hörbuch Gedichte erhältlich. Probehören kann man das Monodram Señora Nada in der Reihe MetaPhon.