Olivier ist schlecht gelaunt.
Die Nachbarn unter ihm streiten schon wieder. Das geht seit zwei Stunden so. Krach und Gebrüll und Gepolter.
Er liegt auf dem Sofa und hält eine Zeitung senkrecht vor den Augen. Ökonomischer Selbstmord der globalen Zukunft, Euthanasieverfahren im Staatsdienst, Homo artifex, quo vadis? Nur so ein apokalyptischer Scheiß über den Untergang der Spezies, Scheiße noch mal! Das ist kein Mal de siècle, sondern pure Millenniumshysterie. Alles geht den Bach runter! Politisch, wirtschaftlich, demographisch stecken wir in der Krise, werden durch Umweltkatastrophen und Seuchen dezimiert und diejenigen, die noch übrig bleiben, werden in naher Zukunft dazu verpflichtet, wenn die Natur oder die Terroristen sie nicht rechtzeitig abmurksen, freiwillig den Abgang zu machen. Die Schreckensreiter der Apokalypse verwüsten die zivilisierte Welt und wir sind schuld daran, das Artefakt rächt sich, Frankenstein ist zum eigenen Monster mutiert und brüllt ohrenbetäubend.
Olivier wirft einen Blick über den Papierrand hinweg auf den Bildschirm. Na, bitte. Im Fernsehen läuft gerade eine wissenschaftliche Sendung über die Gefahren der Eugenik.
Das kann doch nicht wahr sein! Es ist zum Kotzen! Was haben die heute alle? Was ist in sie gefahren? Es ist Sonntag, um Gotteswillen! Auch Gott hat sich am Sonntag eine Pause gegönnt!
Olivier wirft die Zeitung weg und schaltet den Fernseher aus.
Er bleibt auf dem Sofa sitzen, starrt vor sich hin.
Er kann die allgemeine Hysterie nicht akzeptieren, ob politischer oder religiöser Art. Er findet sie abstoßend, wie jede Form von Schwäche. Heute ist er dafür anfälliger als sonst, er fühlt sich selbst ein wenig geschwächt und lustlos. Das macht ihn mürbe. Er kann sich weder an das, was er gelesen, noch an das, was er gesehen hat, erinnern. Zu viel Krach kommt von unten. Sein aufsässig gewordenes Gehör nimmt das Gehirn in Besitz, überschwemmt es mit Informationen, die es nicht haben will. Die Klänge hüpfen albern in seinem Kopf herum wie aufgescheuchte Frösche. Das Ohr ist ein willenloses Organ, das sich dem aufdringlichen Lärm nicht entziehen kann. Olivier legt seine Hände auf die Ohren und presst, bis die Geräusche in dumpf pochender Stille verklingen. So muss sich das Wachstum in einem Kokon anhören. Klaustrophobisch. Er hält es nicht mehr aus und nimmt die Hände weg. Wallendes Gekreische brandet von unten hoch in den Raum.
– „Verdammt noch mal!“ schreit Olivier, nimmt den marmornen Briefbeschwerer vom Tisch und klopft damit in den Heizkörper. Einmal, zweimal, na, jetzt haben sie ihn gehört, werden stiller.
Er kennt sie, es wird nicht lange dauern, bis sie wieder anfangen. Er setzt sich wieder hin und vergräbt sein Gesicht in die Hände.
Den ganzen Morgen hat er vertrödelt, hat sich vom Bett auf den Sessel, vom Sessel auf das Sofa geschmissen, hat Zeitungen durchgeblättert, ist durch die Kanäle gezappt und hat von Zimmer zu Zimmer nach einem ruhigen Plätzchen gesucht. Das Gepolter hetzte ihn durch die Wohnung, er fühlte sich in seiner Intimität angegriffen.
Diese Wehrlosigkeit bekommt ihm nicht.
Machen, machen, die einzig vernünftige Abwehr, er muss etwas tun, hätte joggen oder auf seinem Hometrainer üben können. Morgen früh wird er für vier Tage verreisen und hat noch nichts vorbereitet: Den Papierkram für den Vortrag und mindestens vier frisch gebügelte Hemden. Er wird vermutlich mit den anderen Teilnehmern ausgehen. Es kommt ihm gelegen, dass er gerade jetzt weg muss. Eine gute Ablenkung, neue Gesichter zu sehen. Vielleicht lernt er eine nette Frau kennen. Eine unkomplizierte, ohne Launen. Was fast utopisch ist, denkt er, denn das einzige, was in dem Verhalten einer Frau mit unbeirrbarer Konsequenz vorkommt, ist ihre Launenhaftigkeit.
Olivier steht entschlossen auf, geht in die Mitte des Raums und beginnt mit den fünf Tibetern. Er ist bei der vierten Woche, das heißt, jede Übung wird neunmal durchgeführt. Die erste mag er am liebsten, dieses Drehen um die eigene Achse, wie es die in Trance geratenen Derwische tun. Er atmet tief ein, breitet die Arme aus, hebt den Kopf und schließt die Augen. Es ist ihm bis jetzt noch nicht gelungen, sich mit geschlossenen Augen neunmal hintereinander um die eigene Achse zu drehen, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. Schon bei der dritten Drehung wird ihm schwindlig.
Die Tibeter sollen Wunder bewirken, Körper und Geist in Einklang bringen und beiden ewige Jugend bescheren. Das heißt, die Seele vom Überdruss entschlacken, den Geist von störenden Gedanken. Von dem Gefühl, sich selbst peinlich zu werden, weil man ohnmächtig da sitzt und sich von dem Krach anderer terrorisieren lässt. Olivier dreht sich schneller und schneller, beim fünften Mal schwankt er aber, trippelt auf der Stelle und öffnet die Augen. Er absolviert die weiteren vier Drehungen mit offenen Augen und legt sich auf den Boden für die zweite Übung.
Der Schmerz im Rücken lässt nicht nach, zieht die Wirbelsäule hinauf bis in den Nacken. Wenn er die Knie zur Brust hebt und dann die Beine hochstreckt, tut der verhärtete Muskel unter dem rechten Schulterblatt höllisch weh.
Er muss sich ihn heute Nacht verzerrt haben, besser gesagt heute morgen, als er nach Hause kam und, weil er trotz der langen, ziellosen Autofahrt noch immer nicht schlafen konnte, eine weitere Stunde in der Garage totschlug. Er staubsaugte gründlich das Innere seines Wagens.
Gespenstisch war die Fahrt im nächtlichen Dunst durch die in der regenflüsternden Dunkelheit versunkenen Ortschaften am Rhein, Raum und Zeit nur zufällig durch die schwach blinkenden Lichter verschlafener Vororte oder durch das selten erklingende Gebimmel einer unsichtbaren Kirche wahrnehmbar.
Manchmal hat er dieses Gefühl, dass er in eine fremde Welt geraten ist, deren Beschaffenheit er nicht erfassen kann, hier jedoch eine Auszeit von der ihm eigenen erleben darf.
Für die dritte Übung geht Olivier in die Knie, spreizt ein wenig die Beine, drückt die Hände gegen den hinteren Teil der Oberschenkel und wirft den Kopf so weit wie möglich in den Nacken. Er spürt nicht nur die Rücken-, sondern auch die Brust- und Bauchmuskeln sich jäh dehnen, hört das eigene Blut in den Ohren pochen. Beruhigend, sich selbst zu spüren, festzustellen, dass zumindest noch etwas erkennbar ist und funktioniert.
Dass dies, was er tut, zu dem erwarteten Ergebnis führt. Alles um ihn herum scheint diesem Kausalverlauf zu widersprechen. Olivier ist ein vernünftiger Mensch, gerät nicht so leicht in Panik. Und verachtet alle, die es tun. Ihm gelingt es fast immer mit dem, was er tut, auch das erhoffte Ziel zu erreichen. Sein Leben ist geregelt, sein Lebensraum gesichert, er hat keinen Grund zur Unruhe. Er hat dafür gesorgt, es ist sein Verdienst, er kann nichts dafür, wenn andere es nicht schaffen. Nur im Augenblick befriedigt ihn das nicht.
Dennoch. Er hat eine feste Stelle bei der Stadt und keine Probleme damit, alles zu unternehmen, um sie zu behalten. In der letzten Zeit ist dies in den Vordergrund geraten, es ist nicht zu leugnen, er beschäftigt sich viel intensiver mit der Erhaltung seines Arbeitsplatzes als mit der Arbeit selbst. Er erfüllt seine Pflicht, liefert dieser schwankenden Gesellschaft den erwünschten Steuerzahler. Er entlastet, also will er entlastet werden.
Die vierte Übung ist anstrengender, er führt sie äußerst gewissenhaft durch, erhöht den Schwierigkeitsgrad, um das Erfolgserlebnis zu steigern. Während er den Körper steif wie ein Brett über den Boden hebt und ihn parallel zu diesem gerade zwischen Schultern und Knien anspannt, zählt er bis fünfzehn.
Man soll Probleme mit Selbstdisziplin und regem Gewissen meistern, denkt er. Genau wie Krisensituationen. Stattdessen verursacht man in der heutigen Zeit immer weitere.
Als hätte man Geschick verloren und Vernunft verlernt.
Das geht ihm an die Substanz, weil, ohne sie verschuldet zu haben, er die Konsequenzen des Chaos zu tragen hat. Nicht nur an seinem Arbeitsplatz, wo er ein Projekt nach dem anderen platzen sieht, sondern auch zu Hause, wo er diese blöden Mieter von unten zu ertragen hat. Er kann nicht einmal einen ruhigen Sonntag verbringen. Olivier hält sich nicht für zynisch, sondern für nüchtern. Er sieht die Lage aus einer realistischen Sicht.
So ist der Gang der Dinge. Krisen und Wohlstandszeiten haben sich seit eh und je abgewechselt, das nennt man Fortschritt, und wenn es mal geschieht, dass der Krieg sich tatsächlich als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln entpuppt, geschieht das irgendwo anders und nicht vor seiner Tür. Vor seiner Tür liegt sein Weg und darauf konzentriert er sich. Und jetzt gerade auf die letzte Übung, eine Mischung zwischen Kopfsprung und Liegestütz, die ihn an seine Pubertät erinnert, als er in der Schwimmmannschaft der Schule war.
Er liegt auf dem Bauch, hebt sein Gesäß im geraden Winkel, streckt Beine und Arme aus. Er mag es, die Muskeln anzuspannen, wenn er den angewinkelten Körper langsam wieder in die Gerade bringt und eine Handbreit über den Boden senkt.
Die Übung lenkt ihn jedoch nur unbedeutend ab.
Die Ängste und Vorahnungen, die er hasst, verpesten seine Ruhe. Sie stehen ihm im Weg. Der ist holprig geworden, voller Schlaglöcher und Stolpersteine. Es breitet sich unaufhaltsam aus, das Chaos, man spürt die Folgen. Ob sich der Frieden in dieser Ecke der Welt, in der er lebt, noch lange halten wird? Noch nie war es so lange so still gewesen. Angesichts der ganzen Krankheitssymptome der letzten Jahre beginnt er sich zu fragen, ob es nicht bald wieder zu einem Konfliktausbruch kommen würde. Der würde diesmal ganze Kontinente versengen. Daran will er erst recht nicht denken, nicht heute, bitte, heute ist Sonntag.
Außerdem kann er nichts dagegen unternehmen.
Und wer ist schon davon wirklich getroffen, wenn nicht diejenigen, die überall und zu jeder Zeit stolpern und fallen, die Lebensuntüchtigen, wie seine Nachbarn, die bei jeder Selektion, ob natürlicher oder gesellschaftlicher Art, sowieso eliminiert werden. Das Leben ist ein harter Kampf, wer nicht mithalten kann, ist selber schuld.
Olivier ist mit den Übungen fertig, der Körper fühlt sich wohler, sein Geist aber nicht. Er geht in die Küche, öffnet den Kühlschrank, nimmt die Milch heraus und trinkt direkt aus der Packung. Er hört das Geräusch des Schluckens in seiner Kehle und sonst nichts. Keinen Krach, keine Schreie.
Die Nachbarn haben aufgehört. Wunderbar, er kann nun endlich in Ruhe frühstücken. Es ist spät genug, schon Viertel vor elf.
Sarah kann die Titel kaum lesen, es ist ziemlich dunkel im Raum.
Draußen quält sich der Tag durch die schlammige Wolkenschicht und den Regenschleier durch. Er bricht zuweilen über die Welt hinein, über ihre tauben Wesen, die ausgehungert nach den son-nenlosen Monaten sich hinter den Mauern kraftlos regen.
– „Gar nicht aufmunternd, was ich da habe…“, sagt sich Sarah. „Alle hier schreiben über Begräbnisse, nicht nur die kleine Plath, sondern auch der große Faulkner und das Genie Joyce!“ Sie holt sich Saul Bellows Roman Humboldts Vermächtnis und sucht eine bestimmte Stelle aus. Das wird sie ein wenig aufmuntern.
Es ist eine humorvolle Erklärung, warum Amerikaner ihre toten Dichter, diese armen Irren, lieben. Sie liest einige Passagen.
– „Bei ihm sind sogar die traurigen Szenen witzig“, lacht sie leise, schließt das Buch, stellt es zurück ins Regal.
Sie mag Bellow, die Mischung von nordamerikanisch-jüdischem Humor, sein in Grenzüberschreitungen erfahrenes Blut. Sie mag Mischlinge und Strolche. Die Köter dieser Welt.
Gewiss, weil Sarah selbst sich manchmal als streunender Köter empfindet. Zwischen Kulturen lungernd. Zwischen Zugehörigkeiten schwankend. Auf Forschungsreise entlang der Trennlinien. Unterwegs mit Buch und Buch. Unterwegs mit ihrer Bibliothek.
Dort liegt ihre tragbare Heimat, die einzig wahre, sicher zwischen den Buchdeckeln aufbewahrt. Von Wohnung zu Wohnung, Stadt zu Stadt, Land zu Land mitgeschleppt. Ihr Lebensinhalt in Kartons verpackt, über Grenzen geschmuggelt.
Lebensstationen stecken zwischen den Seiten, Lesezeichen in der Chronik einer Wandernden zwischen Sprachen und Ländern.
Sarahs Blicke streifen über die Titel und ihr Geist streift mit.
Ihr Ist-Zustand.
Sie finden das Buch, das Sarah liebt: Waste Land. T. S. Eliot.
Das Sterben als Hochgebiet der Spekulation, denkt sie. Die anonyme Austauschbarkeit des restlichen Schweigens. Darin der Verlust des Sinns. Manche finden ihn dann doch auf dem Begräbnis anderer wieder, in einer Handvoll Staub.
Sie nimmt Eliot vom Regal.
– And I will show you something different from either / Your shadow at morning striding behind you / or your shadow at evening rising to meet you; / I will show you fear in an handful of dust, liest sie laut aus dem Burial of the Dead. Ja, Angst, Furcht oder das Wort, das nicht ausgesprochen werden kann…
Nicht schon wieder T.S. Eliot! – nimmt Sarah den stummen Protest ihres Publikums wahr. Ein Bewohner des bewährten Babels, dieses unsichtbare Publikum. Von tückischer Natur. Grinst hämisch zwischen den Büchern. Mal ist es da, mal nicht.
Heute ist es da, hockt wie ein debiler Hahn auf dem Misthaufen des Tages. Des Morgens, besser gesagt. Er mischt sich ein, kräht in Ultraschallwellen. Niemand außer Sarah kann dies wahrnehmen. Am liebsten würde sie ihn auf der Stelle erwürgen. Nun, Blödsinn. Ihr Zimmer ist kein Hühnerstall sondern eine Bibliothek! Das Publikum ist sehr beleidigt. Es scharrt, holpert und flattert unentschieden von Titel zu Titel. Was tun, um ernst genommen zu werden? fragt es sich.
Sarah lässt sich nicht ablenken. Sie steckt The Waste Land zurück ins Regal und blickt geradeaus. In ihrer Augenhöhe: A Room of One’s Own.
– „Virginia Woolf war durch und durch ein ethisches Wesen“, sagt sie und nimmt das Bändchen in die Hand. „Ihr Selbstmord durfte vollzogen werden, ihre Schuldigkeit getan, die Bücher geschrieben. Sonst keine Sprösslinge. Korrekt“, entscheidet sie und legt es zurück.
Im Regal stehen mehrere Ausgaben der wichtigsten Romane von Woolf. Die Mutter-Göttin. Sarah hat sie in den vier Sprachen, die sie beherrscht. Die rumänischen Ausgaben sind die ältesten, schon vergilbt. Sie haben die längste und abenteuerlichste Reise hinter sich. Die deutschen, englischen und französischen hat Sarah überwiegend im Laufe der letzten achtzehn Jahre erworben, seitdem sie in Deutschland lebt. Sie mag keinem Buch, das sie lesen kann, widerstehen. So wie sie keines, auch wenn es völlig zerfleddert ist, wegschmeißen kann.
Sie steht vor dem Bücherregal und mag sich nicht entscheiden.
Trotzdem ist sie noch nicht verunsichert. Das Gefühl, sie gleitet von einem bestimmten Titel zu einem anderen bestimmten Titel auf unsichtbaren Fäden, als müsste sie es derart und nicht anders tun, ist ihr gegenwärtig und beständig. Sie ist Arachne, die ihr Spinnennetz inspiziert. Es zwingt sie geradezu, es zu tun. Sie muss jedes Mal die Festigkeit der Knoten, die Vollständigkeit deren Zusammenhalts, ihre Unfehlbarkeit überprüfen. Das Netz hält, die Logik seines Baus gilt nach wie vor. Hier fühlt sie sich aufgehoben. Heimisch. Heute will es ihr aber nicht gelingen, eine Stelle zu entdecken, an der sie rasten kann. Das Netz will sie heute nicht halten, während sie von einem Buch zum anderen torkelt. Zehn vor elf. Sarah sieht zum Fenster hin.
Eine laue Stunde ist das. Ohne Eigenschaften. Wie der Himmel hinter den Fensterscheiben. Grau. Nichts ragt heraus, man kann sich an nichts festhalten. Rundherum gibt es keinen Halt. Keine Sonne, keinen Schatten, ob vor oder hinter dir.
Sie geht zum Fenster und sieht auf die Straße, die etwa neun Meter tiefer liegt. Leer. Ein typischer Sonntagvormittag Anfang Februar. Es regnet. Keiner traut sich bei dem Wetter auszugehen. Es ist weder kalt noch warm für die Jahreszeit. Es ist irgendwie „nirgendwie“. Es ist eher nicht, als dass es ist, weil man es nicht definieren kann. Mit keinem Wort. Keines trifft mit Bestimmtheit zu: weder winterlich, noch herbstlich oder frühlingshaft.
Ein semantisches Vakuum, in dem man erstickt. Man jappst zwischen trostlos und deprimierend, ringt nach Luft, ohne sich für eines der Worte zu entscheiden, weil man dem anderen Unrecht tun würde. Also schweigt man und verlässt den Leerraum zwischen Worten gedemütigt, ohne ihn belebt zu haben. Wie auch? Die Gegend ist still und öde.
Nichts bewegt sich. Kein Mensch, kein Auto, kein Zweig von den unzähligen der drei kahlen Bäume am Straßenrand. Einige Meter weiter stechen die Zweige der Eichen und Buchen, die den benachbarten Park füllen, die Luft.
Durch die Kronen hinweg blickt Sarah auf die gegenüber stehende Hausfront. Sie kann Kathrins Fenster nicht richtig erkennen. Nichts sieht sie deutlich, der Regen wirft graue Netze und verwischt die Konturen. Wüsste sie es nicht, könnte sie nicht richtig einschätzen, wie weit oder wie nah die andere Straßenseite ist. Es gibt keine Hinweise auf Tiefe und Schärfe in diesem Bild.
Keine Kontraste. Keine Farben.
* * *
Am Todestag von Ioona Rauschan erinnert KUNO an diese Autorin mit einer Leseprobe aus: Abhauen. Dieser Roman erschien 2008 beim Pop Verlag, Ludwigsburg.
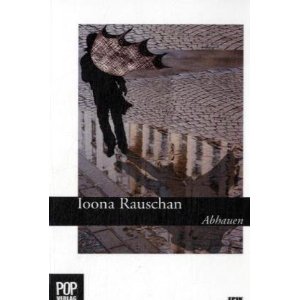
Auf der Schwelle. Ein Filmessay über Heinrich Heine von Ioona Rauschan. Edition Biograph, 1997
Die schöne Strickerin, Novelle von Ioona Rauschan, Edition Biograph, Düsseldorf 1995. (Antiquarisch erhältlich).
Weiterführend →
Ein Kollegengespräch mit Ioona Rauschan findet sich hier. Das Live-Hörspiel 5 oder die Elemente wurde in der Regie von Ioona Rauschan mit Marion Haberstroh und Kai Mönnich im Gutenberg-Museum zu Mainz uraufgeführt. Señora Nada, in der Regie von Ioona Rauschan, ist auf Hörbuch Gedichte erhältlich. Probehören kann man das Monodram Señora Nada in der Reihe MetaPhon.