Daniel beobachtet den solitären Minutenzeiger. Es ist kurz nach halb elf. Zehn Uhr, einunddreißig Minuten und eine unbekannte Anzahl von Sekunden. Irgendwo zwischen der zweiten und der neunundfünfzigsten Sekunde ließe sich sein Unbehagen, wäre es greifbar, ansiedeln. Auf dieser barocken Stehuhr bleibt die Zwischenzeit genau so unauffindbar, wie sein Gefühl undefinierbar. Trauer, Wut, Sehnsucht? Das alte Möbelstück ohne Sekundenzeiger verschweigt den Augenblick, der gerade verstreicht. In der Zeitspanne zwischen einer Minute und der nächsten scheint sich auf dem perlmuttfarbenen Zifferblatt nichts zu bewegen.
Man muss den Kopf ein bisschen heben, um darauf zu schauen. Die Uhr ist zwei Meter hoch, hat einen gold verzierten Giebel, der einem geschmacklosen Hut mit hölzernen Blumen sehr ähnlich sieht, und riesige runde Hüften an den Seiten. Dicke Bertha nennt David das anthropomorphe Monstrum.
David schläft noch in ihrem Schlafzimmer.
Klick! Die Spitze des Minutenzeigers rückt auf zweiunddreißig Minuten, ein Zentimeter weiter nach Südwesten in Richtung VII. Sie friert wieder ein. Sieben, die magische Zahl, im Augenblick noch unerreichbar, denkt Daniel, der gern mit Symbolassoziationen spielt. Sieben: für Agrippa, Einheit zwischen Leib und Seele. Die Zahl der himmlischen Sphären und der liberalen Künste für Dante. Zahl der Leuchten der Menora, Äste des Lebensbaums. Zahl der Chakras, der Menschenalter und der sich stets erneuernden kosmischen Zyklen.
Sinnbilder. Sie ziehen unzerrüttet ihre Pfade in alle Himmelsrichtungen, flechten beharrlich die Leiter zwischen Körper und All, auf die wir schwankend, aber unermüdlich klettern. Aus dem Urgedächtnis emporsteigend, reißen sie gelegentlich die Mauer monotheistischer Festungen ab, reduzieren sie auf lächerlich vergängliche Erscheinungen.
– „Und für uns?“ fragt Daniel. Der siebte Tag, Tag der Ruhe und der Vervollkommnung, Dynamik des Absoluten, Anfang im Ende. Ein jüdisch-christliches Paradoxon, wahrhaftig voller Demut.
– „Sieben an der Stelle aller anderen Zahlen auf diesem Zifferblatt… Surrealistisch. Das wäre gerecht!“, murmelt Daniel.
Der Symmetrie halber zwölfmal die unsymmetrische Sieben. Die Zeit zwölfmal unsymmetrisch sprengen. Den Blick dieses dumpfen Monstrums stechen, seines runden Bleichgesichts, das unter Kurzsichtigkeit leidet und jenseits der ewig wiederholten zwölf Stunden nichts zu sehen vermag. Booom!
Ohne den Minutenzeiger aus den Augen zu verlieren, tastet sich Daniel Schritt für Schritt rückwärts bis zum Schreibtisch. Er fühlt mit der ausgestreckten Hand die Kante des Sessels und findet die Armlehne. Er setzt sich hin, seinen Blick noch immer auf das Zifferblatt gerichtet. Seine Finger führen die Bewegungen automatisch durch und schalten den Rechner ein. Er hört dem leichten Brummen zu, wie es wächst und dann allmählich verklingt.
Im rechten Augenwinkel nimmt er das blaue Flimmern des Bildschirms wahr. Würde ihn David dabei beobachten, würde er meinen, dass Daniel sich wieder seinem albernen Sinnestäuschungsspiel hingibt.
Nun, wohl, das tut er. Es lenkt ihn von seiner Ohnmacht ab.
David war erst um vier Uhr morgens nach Hause gekommen.
Sie hatten Streit. Daniel konnte danach nicht mehr einschlafen. Er lag wach im Bett und erstickte in der Dunkelheit.
Das Schlafzimmer stank. Die Laken stanken. David stank. Nach Wein und Zigarettenrauch. Partygestank. Der Gestank Fremder, den David in den Raum mitgebracht hat, in das Bett ihrer Intimität, auf dem nun Daniel schlaflos lag. Es roch nach Fäulnis, steigerte er sich in seiner Wut. Nach der Fäulnis jener abgenutzter Worte, die ungeachtet ihrer Würde auf einer Menschenversammlung fallen, zufällig und unverbindlich über den Haufen geschmissen werden. Geschändete Worte, von der unförmigen Belanglosigkeit des Smalltalks verunstaltet, ertranken in der Dunkelheit des Schlafzimmers vor seinen offenen, feuchten Augen. Der schwache Schein des Mondes lag kraftlos auf der gegenüberstehenden Wand. Daniel konnte den Schimmer eingesabberter, zerklumpter Worthaut erkennen, konnte die Wortkörper aus den Mündern fallen sehen, wie abgetriebene Fötusse, die aus Leib und Leben heraus purzeln. Tote Worte.
Er schwelgte in kathartischer Entrüstung wegen all derjenigen, die keine Ahnung haben, wie sehr es schmerzt und wie viel es kostet, Worte zu gebären. Oder bloß welche zu finden, die kristallklare Reflexe werfen. Sie zu ehren, so wie er es tut. Oder zumindest versucht, es zu tun. Das Auge des Mondscheines blinzelte auf der Wand. Die Jalousien zitterten flüchtig.
Eine unendliche Nacht.
Neben Davids rhythmisch atmendem Körper wich Daniels Unmut gegen Morgen einem anderen Gefühl aus, das er nur als Solidarität mit den abgetriebenen Worten so vieler Verächter beschreiben konnte. Denn das waren sie, dachte er. Davids Kollegen aus der Redaktion waren die typischen Wortverächter, weil sie deren Wesen erkannten und dennoch verrieten.
Daniel hatte selbst eine Weile in dieser Redaktion gearbeitet. David hatte ihn dort eingeführt, kurz nachdem sie sich kennen-gelernt hatten. Die wenigsten unter den Redakteuren benutzten eine persönlich gestaltete Schreibe. Daniel nahm sich einmal vor, ihre klischeeartigen Idiome aufzulisten. Sie schoben Wortpakete hin und her, reichten sie von einem zum anderen weiter, als wären sie gemeine Gebrauchsgüter, Bürsten, Lappen, mit denen sie sich die verschlissenen Schuhsohlen putzten. Sie dachten vielleicht, sie wären dazu berechtigt, weil sie gemeinsam durch den Sumpf gegenseitiger Scherereien und alltäglicher Intrigen gewatet waren. Eine verhängnisvolle Verschiebung der Linse.
Glaubt man den Gerüchten, wird das Erscheinen der Zeitung im Sommer eingestellt. Dann wird alles ein Ende nehmen.
Daniel wirft einen Blick auf die Schlafzimmertür. Nein, sie bewegt sich nicht, es ist nur das graue Licht im Raum, das flimmert. David schläft noch. Oder tut so als ob.
Und er, Daniel, fühlt sich elend.
Er richtet den Blick wieder auf Berthas Bleichgesicht und wartet, dass die Zeit an ihm vorbei geht. Sie steht still.
Er hat David hemmungslos angeschrieen. Blöd, was er tut, den einzigen Menschen, den er liebt, wegzuekeln. Eine widergespiegelte Selbstzerstörung ist das. Er nimmt Antidepressiva seit Wochen. David weiß nichts davon, darf es nicht erfahren.
Der Arzt sagte, die Pillen würden nach vier Wochen wirken. Er nimmt sie seit fünf und spürt nichts. Er darf keinen Alkohol trinken, hat zugenommen. Das sind die Wirkungen, die er wahrnimmt. Der Alkohol fehlt ihm. Es ist bloß Quälerei, er kann sich nicht konzentrieren.
Alles ist unsäglich sinnentleert. Seine Handlungen sind Krücken. Sein Leben – ein Placebo: Ersatzerlebnisse und Ersatzlösungen. Die Entscheidungen falsch. Von Perfektionsansprüchen und Kraftlosigkeit zunichte gemacht. Die Zwillingsfratzen der Ohnmacht und der Selbstverachtung blecken ihre Zähne, knurren ihn an. Er kennt sie.
Klick. Zehn Uhr vierunddreißig Minuten. Noch eine Unze Zeit in das südwestliche Loch hineingeschleust. In den Löchern zwischen den Zahlen gärt die Zeit. Zeitingredienzien vereitern dort, Zeitnuancen verblassen. Die Wartezeit zerfällt. Anderswo siecht die andere dahin, die verschenkte Zeit. Seine und Davids, die er anderen widmet. Seinen Kollegen, Freunden.
Ist er eifersüchtig? Früher hat ihn das nicht gestört. Auf jeden Fall nicht am Anfang, als sie sich begegneten. Eine Episode seines Lebens so nah an der Verwirklichung der Utopie, dass er sie heute mit Leichtigkeit verklärt. Von sprühender Kreativität durchdrungen. Sein Hirn wucherte wie eine gierige, fleischfressende Pflanze, die er ständig mit Ideen fütterte, und schlug wundersame Wurzeln in seinem ganzen Körper. Die Wege zwischen Fühlen und Denken waren dicht belegt, kein Tropfen wurde verschwendet, alles blühte sinnvoll, tränkte die Zeit mit Gerüchen, die einen berauschten. Es floss aus ihm, die Droge des Glücks.
Auf einer Lesung sah er David und erlitt einen Schock.
– „Erstarrt, wie Ganymed, als der Adler über ihn herfiel“ – scherzte er später in Davids Armen. „Das einzige, was ich noch denken konnte, war, dass ich deinen Durst stillen muss. Ich will von deinem Mund getrunken werden. Mit meinem Schweiß, meinem Blut, meinem Samen“, hatte er ein wenig pathetisch hinzugefügt.
Scheinbar ist er jetzt leer und David satt. Der sucht schon lange seinen Mundschenk unter anderen Spendern, die ihm andere Elixiere eingießen. Hoffnung, Vertrauen, Freundschaft.
Wenn er jetzt darüber nachdenkt, sagt sich Daniel, ist er ihnen nicht böse. Sein Verdruss wirkt weich, eine Welle, die verklingt. Es ist nicht mehr allein sein Privileg, der Wut zu frönen. Davids Kollegen tun es auch, wenn auch aus anderen Gründen. Das lässt ihn fraternisieren. Er kann ihre Wut nachvollziehen, fühlt mit, verspürt einen Anflug von Mitleid.
Sie beziehen die Definition ihrer Existenz allein darauf, ob diese Teil des geregelten Gefüges ist oder nicht. Einmal aus diesem hinaus geworfen, vermögen sie kein anderes, für sich funktionsfähiges zu finden. Außerhalb des Geregelten verbüßen sie ihr existentielles Stehvermögen. Zumindest nimmt er das an und das rührt ihn und lässt ihn sie gleichzeitig verachten.
Er fühlt sich überlegen. Er ist seit Jahren darin geübt, den Ausgestoßenen abzugeben. Er weiß, wie man aus dem Raster zu fallen hat. Er verletzt sich kaum, landet mit wenigen Kratzern heil auf dem Boden der eigenerschaffenen Zuflucht: seiner Literatur. Ein sicheres Gefüge, das abnorme Formen zulässt, ohne gleich darunter zu zerbrechen. Ob das eine Lösung ist? Vielleicht macht er sich etwas vor und seine Strategie ist längst fehlgeschlagen. Es bricht um ihn herum auseinander. Er ist aus seinen Gefügen heraus geworfen worden. Er gehört nirgendwo mehr hin. Und dies hat kaum noch etwas mit Literatur zu tun.
Der Minutenzeiger steht auf fünfunddreißig. Endlich VII.
Die Sieben für die Ewigkeit der nächsten sechzig Sekunden.
Wann hat der Zeiger sich bewegt? Sein Blick hing die ganze Zeit an dessen Spitze und dennoch hat er das Rucken nicht gesehen.
– „Die Wahrnehmung fließt an mir vorbei“, flüstert Daniel.
Umsonst hechelt er ihr hinterher, die Sinnestäuschung übernimmt die Kontrolle und lässt ihn zurück. Er bleibt zwischen ihren un-sichtbaren Wurzeln hängen.
Er verfängt sich in vergeblicher Hermeneutik.
Was entzieht sich der Vergeblichkeit?
Das Schreiben?
Wenn er nicht daran glauben würde, könnte er jetzt gleich aufhören. Könnte gleich sterben.
Im Schlafzimmer liegt David seit einigen Minuten wach im Bett.
Er fühlt seine Zunge rau, den Mund trocken. Der Kopf schmerzt. Katerübelkeit. Die andere Seite des Bettes ist leer. Er sieht zum Fenster hin und schließt die Augen. Schwindlig. Er öffnet sie wieder. Das Bett driftet eine Weile durch den Raum, dann ankert es an gewohnter Stelle. Im Morgenlicht ist alles karg, bloßgestellt. Es lässt sich nennen: Existenzangst.
Wie soll es ab Sommer weiter gehen?
Auf der Party, die alles andere als eine Geburtstagsfeier war, fielen Worte wie Risikoreduzierung, Verlustvorbeugung, Gewinnsteigerung: Heilige Kühe ferngebliebener Landschaften.
In ihren Mündern schmeckte ihr Fleisch feindselig zäh, in ihren Bäuchen harrten unverdauliche Klumpen. Diese Art von Gericht bekam ihnen wohl nicht. Ihr Geschwätz war bloß lächerliches Wiederkäuen unter Sozialhypnose. „Armselig“, denkt David, „wir verausgaben uns im Diskurs und haben kaum noch Energie übrig fürs Handeln. Deshalb wird man uns widerstandslos aus dem Weg räumen. Es ist einfacher, sich fallen zu lassen, als sich aufzurichten.“
Er legt Daniels Kissen übers Gesicht. Es riecht nach Daniel.
Er dreht sich auf den Bauch, wirft einen Blick auf den Radiowecker: 10:35:28. Er sollte aufstehen und ins Bad gehen. Wo ist Daniel? Er hört ihn nicht, vielleicht ist der gerade im Badezimmer. Wäre er allein, denkt David und schiebt die Wange wieder auf sein Kissen, hätte er weniger Angst vor der Zukunft.
Er schließt die Augen und nimmt die Eintönigkeit der Stille wahr. Nein, es ist nicht die Stille, es ist der Regen. Davids Gedanken gedeihen in Zeitlupe. Er könnte Daniel von der herunterprasselnden Welt nicht schützen, auch wenn er wollte, flüstert ein letzter Gedanke. Im Halbtraum sieht er Daniels dünnen Körper in der Mitte knicken. Er bricht wie ein Streichholz, das noch eine Weile flackert und dann erlischt.
* * *
Am Todestag von Ioona Rauschan erinnert KUNO an diese Autorin mit einer Leseprobe aus: Abhauen. Dieser Roman erschien 2008 beim Pop Verlag, Ludwigsburg.
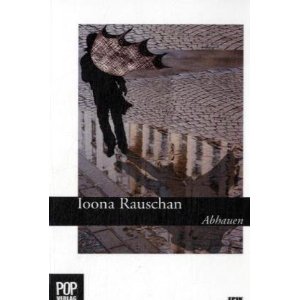
Auf der Schwelle. Ein Filmessay über Heinrich Heine von Ioona Rauschan. Edition Biograph, 1997
Die schöne Strickerin, Novelle von Ioona Rauschan, Edition Biograph, Düsseldorf 1995. (Antiquarisch erhältlich).
Weiterführend →
Ein Kollegengespräch mit Ioona Rauschan findet sich hier. Das Live-Hörspiel 5 oder die Elemente wurde in der Regie von Ioona Rauschan mit Marion Haberstroh und Kai Mönnich im Gutenberg-Museum zu Mainz uraufgeführt. Señora Nada, in der Regie von Ioona Rauschan, ist auf Hörbuch Gedichte erhältlich. Probehören kann man das Monodram Señora Nada in der Reihe MetaPhon.