„Mein zweiter Name ist auch Sylvia“, sagt Sarah Sylvia Sander, während sie in einem Erzählungsband von Sylvia Plath blättert. Sie findet, sie habe mit der Plath, trotz des gleichen Vornamens, nichts gemeinsam. Nichts.
Es sei denn zuweilen die Todessehnsucht.
Im Gegenteil zu der Plath, denkt Sarah und schließt das Buch, sei sie schuldfrei geblieben: habe keine Kinder in die Welt gesetzt, habe sich nicht darin versündigt. Habe den Weg frei gehalten: es gibt niemanden, den sie überfahren würde. Versehentliche Unfälle seien wahrscheinlich, selbstverschuldete Morde ausgeschlossen. Verschwinden könne sie, ohne Schaden anzurichten. Zu jeder Zeit und spurlos. Die höchste Form der Freiheit – sich bei anderen nicht zu verschulden.
Nicht mit Schmerz.
Nicht mit uneingelöster Liebe.
Es geschieht in dem Alptraum, der neulich ihre Nächte heimsucht: Jemand steckt ihr eine Waffe in den Mund und schießt. Es gibt auch Abweichungen. Zum Beispiel, falls dieser jemand nicht bereit ist, zu schießen, versucht sie, ihn durch Telepathie dazu zu zwingen. Im Traum gelingt es ihr meistens.
Beim Knall wacht sie auf. Erleichtert manchmal.
– „Wo bleibt die Ethik? Zwei Kinder, darunter ein Säugling. Darf die Literatur über die Ethik hinweg interpretiert werden?“ wendet sie sich mit dem geschlossenen Buch in der Hand dem unsichtbaren Publikum zu, das ihre Bibliothek bewohnt. „Ja, wenn getrennt ausgeübt. Denk an Pound, an Céline. Du verwechselst die Ebenen… Plath ist ein anderer Fall… Sie entzieht sich der Ethik nicht, sie zerbricht darunter…“
Sarah betrachtet die Fotografie auf dem Umschlag, die Plath an ihrer Schreibmaschine zeigt. Eine zarte Gestalt, mit schmollendem Mund und gesenktem Blick, der auf den Titel des Bandes zu fallen scheint: Die Bibel der Träume.
Je länger Sarah hinsieht, umso mehr steigt in ihr die Wut.
Wut über den Alltag, der Sylvia Plath umgebracht hat. So viele andere auch, die für den alltäglichen Gebrauch im alltäglichen Geschehen nichts taugten. Das alltägliche Geschehen funktioniert hervorragend ohne sie, vielleicht gerade deswegen, weil sie dort nichts verloren haben. Sie finden sich dort nicht mehr zurecht, wie Frau Birska, die über der Redaktion wohnte und sich vor zwei Wochen das Leben nahm.
Sarah hegt einen persönlichen Groll gegen den Alltag.
Ihr wolle es nicht gelingen, ihn zu transzendieren, rechtfertigt sie sich, wenn das Thema in ihrem Bekanntenkreis angesprochen wird. Die Diskurse über das daseinsberechtigende Glück, das in den kleinen Pflichten und Handlungen des Alltags zu finden sei, versetzen sie in Rage. Nicht weil die Behauptung an sich falsch wäre, sondern weil sie als Alibi meistens dann eingesetzt wird, wenn größere Aufgaben nicht zu bewältigen sind. Es geschieht aus existentieller Fahrlässigkeit. Nein, denkt Sarah, die nicht nur anderen, sondern auch sich selbst gegenüber sehr streng ist, sie kann im Alltag die überwältigend sinnvolle Metapher des Lebens mit gutem Gewissen nicht sehen. Sie sieht darin eher einen andauernden Qualitätsmissbrauch, der das Leben verschleißt.
Diesem Verschleiß um jeden Preis ein Ende setzen zu wollen, ohne an die Konsequenzen zu denken, wie Sylvia Plath, wie das möglich sei, was geht in einem vor, das möchte Sarah wohl nachvollziehen können.
Sonst kann sie darüber keinen vernünftigen Artikel verfassen.
Sarah wirft einen letzten Blick auf den Umschlag und schiebt Sylvia Plath zurück ins Bücherregal. Nein, sie mag sie heute nicht lesen.
– „Wenn der Selbstmord einen anderen außer einem selbst trifft, kippt er wie ein schlechter Wein“, erinnert sich Sarah an Davids Worte. „Man dekantiere Selbst von Mord und was übrig bleibt“, meinte er am Anfang ihrer Recherche, „ist der emotionale Mord an die Verbliebenen.“
Ob er Recht hat?
Sarah überfliegt die Namen auf dem mittleren Regal, der Blick bleibt nirgendwo haften. Er gleitet ohne Hindernis, streift die leuchtende Anzeige des Weckers, registriert: zehn Doppelpunkt fünfzehn, wandert weiter und landet auf einem vertikalen Streifen Schrift: Die Kinder der Toten. Jelinek, eine ihrer Göttinnen.
– „Der Tod ist ein Hauptdarsteller, über jegliche Kritik erhaben“, hatte David gesagt. „Er ist die wahrscheinliche Erfüllung des versprochenen ewigen Lebens, der Kern zeitloser Allgegenwärtigkeit, der einzige, in den wir mit Gewissheit beißen werden, ob wir dazu berufen sind oder nicht, ihn zu veredeln. Unsere Sterblichkeit als Garant unserer Unsterblichkeit. Ein Paradoxon, das uns wahnsinnig macht“, hatte er gesagt. „Der Tod ist deshalb eine brauchbare Metapher. Für jeden begreiflich. Er lässt uns die Anti- nomie jenes Alltags nachvollziehen, den wir transzendieren müssen, um dem sinnvollen Logos nachzuspüren, um des Lebens kostbare Definitionsbrocken aufzulesen… kleine Diamanten auf dem Kiesweg…“
Dem sinnvollen Logos? Erschütternd – Davids Robustheit!
Andererseits, wenn wir unsere durch die Antinomie in Aufruhr versetzte Sinneswelt akribisch zerlegen, denkt Sarah und lässt ihren Blick weiter über die Bücherrücken streifen, hilft uns dies, den Sinn im Logos zu entdecken? Führt es zu einer Erkenntnis, die dadurch erkenntniswert sein könnte, dass sie sich auf andere übertragen ließe? Ist das ethisch vertretbar? Die Autoren, die sich mit dem Tod auseinandersetzen und dabei die Parabel einer Sinnsuche erschaffen, verändern sie die Welt? Wenn sich ihre individuelle Erfahrung metaphorisieren lässt, verharmlost sie den Tod?
Versöhnt sie uns mit ihm?
– „Nein, ich glaube es nicht…“, flüstert Sarah.
Sie haben darüber in der Redaktionssitzung diskutiert. Vor zwei Wochen, als sie erfuhren, dass Frau Birska tot aufgefunden wurde. Wodurch manifestiert sich die Todessehnsucht? – haben sie schnell das Theoretische an den Ohren gepackt und es aus ihrem behüteten Gewissen hervorgezaubert. Wer hätte erahnen können, dass sich eine so quirlige alte Dame umbringen würde? – empörten sie sich. Und überhaupt, wer könnte schon die Eigenschaft des Wesens, Todessehnsucht zu empfinden, erklären? Die Psychologie, die Soziologie, die Religion, die Naturwissenschaft? Vielleicht die Philosophie? Oder die Kunst?
Gibt es ein erkennbares Ursache-Wirkungsmuster für das regelmäßige Auftauchen der Todessehnsucht im öffentlichen Diskurs? Ist Selbstmord nicht doch eine unverzeihliche Impietät? Ist dieser Impietätsgedanke seinerseits nicht bloß ein Reflex unserer christlich geprägten Sozialisierung?
Je länger sie über die Todessehnsucht sprachen, umso hochmütiger wendeten sich ihre Gedanken von deren beinahe physischer Präsenz ab. Jene verharrte eine Etage höher, in der leeren Wohnung der Toten, und vollbrachte in regloser Entschlossenheit eine unpersönliche Absolution. Hier unten konnten sie nicht mehr, als sich durch die Rhetorik über das Thema hinwegretten, weil ihnen diese einen noch soliden Boden unter den Füßen bot. Was in der Luft lag, war ein Sinnrest, der sich dem ganzheitlichen Sinn stur entzog.
– „Ich mochte die alte Dame...“, sagte schließlich Lars.
Frau Birska wohnte im Dachgeschoss. Als die Zeitschrift die ersten beiden Etagen des Gebäudes vor zwanzig Jahren gemietet hatte, lebte sie bereits dort, eine lustige, etwas exzentrische, äußerst freundliche Siebzigjährige. Frau Birska verreiste öfters für längere Zeit und hinterließ ihre Schlüssel bei Frau Hunderrich, der Redaktionssekretärin, die sich um ihre Pflanzen kümmerte. Nicht wenige aus der Redaktion hatten schon mal auf einen Plausch bei Frau Birska in der Küche gesessen. Einige durften sogar die in den zwei kleinen Zimmern untergebrachte Sammlung von skurrilen Mitbringseln bewundern. Die unerschrockene Globetrotterin trug Schmuck und Gewänder aus den Ländern, die sie bereiste, spielte unmögliche Instrumente und sprach leidenschaftlich über Politik. Sie war ein Paradiesvogel.
In den letzten Jahren schrumpfte sie immer mehr zusammen und wurde schweigsamer. Zuweilen musste sie ins Krankenhaus gebracht werden. Seit einem Jahr hatte sie die Wohnung kaum verlassen. Sie wollte keine Besucher mehr empfangen, allein Frau Hunderrich durfte ab und zu nach ihr sehen. In den letzten Wochen kam eine Krankenschwester täglich vorbei und gab ihr eine Spritze. Sie war diejenige, die einen Tag zuvor Frau Birska tot fand. Die alte Dame lag auf dem Bett in einem weißen Seidenkimono. Sie hatte sich an ihrem neunzigsten Geburtstag eine Plastiktüte über den frisch frisierten Kopf gezogen und war erstickt.
– „Wisst ihr, dass dies die von „Exit“ aus der Schweiz meistempfohlene Methode ist? Gibt es überhaupt eine Ermittlung?“ fragte Ulla.
– „Nein. Es ist offensichtlich Selbstmord gewesen. Sie hat einen Abschiedsbrief hinterlassen. Die Anweisungen für die Bestattung und ihr letzter Wille lagen auf dem Tisch…“, berichtete David. „Ich habe mich erkundigt, war neugierig. Sie hat ihre Sammlung dem Ethnographischen Museum in Reykjavik vermacht. Die Begründung lautete, dass Island das einzige europäische Land war, das sie nicht bereist hatte, und sie könnte es derart zumindest post mortem tun“, lachte David zärtlich. „Uns hat sie auch etwas vermacht: Ihre Pflanzen!“
In der sich unendlich hinziehenden Stille hörte sich Sarah sagen, sie wolle einen Artikel zum Thema: Selbstmord in der zeitgenössischen Literatur schreiben.
Sobald sie es aussprach, wusste sie es. Sie begab sich freiwillig in eine Falle. Sie war bereit, wartete darauf, dass die eisernen Kiefer zusammenfallen und ihre Kehle zersägen.
Es ginge ihr darum, setzte sie fort, auf alternative Denkprozesse hinzuweisen, die sich von der üblichen Moral distanzierten und sie in Frage stellten. Diese Einstellung schien ihr die einzige, die in der Runde akzeptiert werden konnte. Das „alternative Denken“ war eine sozialkritische Reflektion, die salonfähig war, solange sie sich brav auf die abstrakte Ebene beschränkte. Solange sie in der Kunst, also in einer illusorischen Welt auftauchte. Sarah versuchte, das Zittern ihrer Stimme zu kontrollieren. Dennoch schwollen die Worte vor Emphase unbeherrscht auf ihren Lippen. Zu einer Zeit, sagte sie, in der die Apologie der Apokalypse in höheren Foren unter scheinbar moralisch und ethisch begründeten Gesichtspunkten betrieben wurde, empfände sie es als ihre zwingende Pflicht, sich als Intellektuelle mit den Folgen, nämlich gerade mit den selbstmörderischen Handlungen unserer zivilisierten Gesellschaft, auseinanderzusetzen. In dieser globalisierten Welt litten wir bereits darunter! Unüberbrückbare Gefälle zwischen Arm und Reich, Kriege, religiöser und ethnischer Fanatismus, genetische Manipulation. Die alleinige Verfolgung materiellen Glücks, die medialisierte Gewaltverherrlichung, die geistige Abstumpfung…
– „Hör doch auf, Sarah! Du predigst schon wieder! Selbstmord ist auf keinen Fall eine Alternative!“ unterbrach Ulla.
– „Diese morbide Neigung zur Innereienanalyse kann dir gefährlich werden, Sarah! Du könntest daran ersticken!“ sagte barsch Swen. „Der Selbstmord ist kein Aufruf zur Revolution! Du ideologisierst, diese Selbstgerechtigkeit ist eine widerlich pathetische, osteuropäische Intellektuellenmasche. Hier zieht so etwas seit den 68ern nicht mehr!“ fügte er hinzu.
– „Denkst du ehrlich, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt für so ein Thema? Es gibt doch keinen aktuellen Anlass dafür, oder?“ fragte Lars, der sich als guter Chefredakteur bemühte, zunächst die redaktionellen Gesichtspunkte zu erwägen und nicht die persönlichen seiner Kollegen.
Nein, das Wort ließ sich nicht äußern, es steckte viel zu tief in jedem von uns drin, dachte Sarah.
– „Fühl dich nicht gleich angegriffen, Sarah! Das Thema ist knifflig“, sagte Lars. „Recherchiere, schreib deinen Artikel, wenn du möchtest, dann sehen wir weiter. Mache es, aber bitte, ohne Moralinsäure. Such dir einige Berühmtheiten aus. Ein Stück gut kalibrierter Horrorvoyeurismus ist immer unterhaltsam und wir müssen es nicht gleich veröffentlichen. Wir warten auf einen Aufhänger. Du machst, wie gehabt, deine aktuellen Themen und dieses nur nebenbei. Und sieh mal nach, ob du auch einen Betroffenen, einen noch lebendigen Selbstmörder unter den Schriftstellern auftreiben kannst“, lachte er schließlich. „Du hast drei Wochen. Und jetzt Themenwechsel bitte“.
* * *
Am Todestag von Ioona Rauschan erinnert KUNO an diese Autorin mit einer Leseprobe aus: Abhauen. Dieser Roman erschien 2008 beim Pop Verlag, Ludwigsburg.
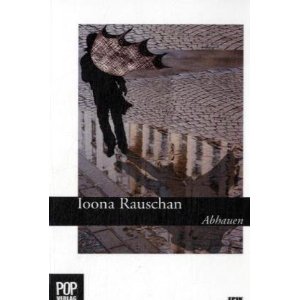
Auf der Schwelle. Ein Filmessay über Heinrich Heine von Ioona Rauschan. Edition Biograph, 1997
Die schöne Strickerin, Novelle von Ioona Rauschan, Edition Biograph, Düsseldorf 1995. (Antiquarisch erhältlich).
Weiterführend →
Ein Kollegengespräch mit Ioona Rauschan findet sich hier. Das Live-Hörspiel 5 oder die Elemente wurde in der Regie von Ioona Rauschan mit Marion Haberstroh und Kai Mönnich im Gutenberg-Museum zu Mainz uraufgeführt. Señora Nada, in der Regie von Ioona Rauschan, ist auf Hörbuch Gedichte erhältlich. Probehören kann man das Monodram Señora Nada in der Reihe MetaPhon.