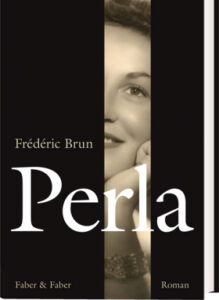Der 2007 mit dem Prix Goncourt du premier roman ausgezeichnete Familienroman, 2017 ins Englische übersetzt, erlebt nun – zum 75. Jahrestag der Vernichtung der Nazi-Herrschaft – endlich auch seine deutschsprachige Premiere. Frédéric Brun, 1960 in Paris geboren, gehört zur dritten Generation von Autoren, die sich mit den psychischen, traumatischen Folgen einer Terrorherrschaft auseinandersetzten, deren Träger einen rassistischen Wahnsinn nicht nur innerhalb ihres staatlichen Territoriums umsetzten, sondern europaweit – oft auch mit Unterstützung staatlicher Kräfte und Nazi-Kollaborateure – die physische Vernichtung „fremdrassischer Elemente“ praktizierten.
Auch Perla, eine Französin jüdischer Konfession, geriet im Sommer 1944 mithilfe der französischen Miliz in die Hände der Nazi-Häscher, wurde nach Auschwitz deportiert, und überlebte das Inferno der Massenvernichtung dank eines fürchterlichen Zufalls. Sie war in die Hände des berüchtigten Nazi-Arztes Mengele gefallen, der mit ihr seine mörderischen „erbspezifischen“ Experimente durchführte. Dass sie diese Attacken auf ihren Körper überlebte und fünfzig Jahre lang an tiefsitzenden traumatischen Depressionen litt, bildet den Hintergrund der Erzählung. Der Erzähler – der Sohn von Perla – berichtet in einigen Andeutungen über die Auswirkungen der brutalen Experimente an dem Körper seiner Mutter. Er fügt seiner immer wieder unterbrochenen Erzählung einige Fotografien aus Perlas Fotoalbum bei. Es sind Bilder, die seine Mutter während eines späteren touristischen Besuchs in Auschwitz angefertigt hat. Außerdem enthält die Publikation eine Fotografie, die eine Parkbank vor einem Krankenhaus zeigt, in der Perla ihre letzten Lebensjahre verbrachte.
Auf den ersten Blick als rätselhaft erweisen sich – mit einer Ausnahme, eine Reproduktion des Titelblatts von Vassili Grossmans, L’enfer de Treblinka – die anderen Fotografien. Es sind Porträt-Reproduktionen von Friedrich von Hardenberg, dem Dichter Novalis (S. 15) und Friedrich Hölderlins (S. 59), wie auch von einigen Bildreproduktionen des Malers Caspar David Friedrich. Ihre Werke gehören zum Kanon der deutschen Romantik. Diese erstaunlichen bildlichen und literarischen Querverbindungen zu Personen und Werken berühmter deutschsprachiger romantischer Dichter und Künstler geben Anlass zu einer Aufklärung, die der Autor Brun zu leisten versucht:
Nach dem Tod meiner Mutter habe ich beinahe alle Bezugspunkte verloren. Einen aber nicht. Seltsamerweise fühlte ich mich gleichzeitig vom deutschen Bildungsroman und jenen Helden angezogen, deren Namen die einer anderen Zeit sind: Wilhelm Meister, Heinrich von Ofterdingen, Andreas Hartknopf … Deutschland gibt es zweimal. Das Deutschland der Lager und Stacheldrähte im Kontrast zu den dunstverhangenen Ebenen, den orangefarbigen Sonnenuntergängen, den idealistischen Poeten: Novalis, Hölderlin, die sich der Weltseele verschrieben haben. Warum bin ich von diesem Land so fasziniert, das zwischen dem Lied und der schroffen Stimme, dem Raffinement und der Barbarei gespalten ist. Wie verwunderlich, in ihm meine Lieblingsliteratur und die Spuren einer Vergangenheit finden zu wollen, die Perla gebrochen haben. (S.15f.)
Auf der Suche nach den Ursachen für die „seltsame“ Anziehungskraft des deutschen Bildungsromans von Novalis und Hölderlin wie auch der magischen Hinwendung zu den naturbeseelten Gemälden von Caspar David Friedrich auf den französischen Autor wird der von verwunderten Eingebungen erfüllte Leser drei Passagen wahrnehmen: „Für Novalis müssen wir mehr als nur Menschen sein. Dank unserer Sinne sind wir in der Lage, alles wahrzunehmen. Nur durch die Poesie sind wir fähig, über uns hinauszuwachsen (Überbildung). In uns schlummert ein kosmisches Meer, aber die Erfahrung entfernt uns auch davon.“ (S. 17)
Eine andersartige Affinität zum deutschen Bildungsroman entdeckt er bei der Lektüre von Friedrich Hölderlins „Hyperion“: „Wie Hyperion suche ich nach einer Epoche, die endgültig begraben ist. Nach ihm müsste unser einziges Ziel darin bestehen, die Schönheit und Einheit der Welt wieder zu finden, das goldene Samenkorn, aus dem wir alle entstanden sind.“ (S. 58) Doch Hölderlin sei sich auch der Zerrissenheit „seines“ Hyperions bewusst gewesen, der auf der vergeblichen Suche nach Glückseligkeit auf dem Boden der göttlichen Antike gescheitert sei, denn, so Brun „wir sind wie ein Laubblatt, das sich vergeblich bemüht, auf den Baum zurückzufinden, von dem es gefallen ist.“
Und nun folgt die überraschende, wenn auch durchaus schlüssige Deutung für die Anmaßungen der Nazi-Ideologen, Hölderlins Botschaften für ihre verruchte Mischideologie zu usurpieren. Ausgehend von drei Elementen ihrer Machtideologien: Verurteilung des kleinbürgerlichen Kapitalismus, Rückkehr zum Sakralen und der grotesken Verehrung des germanischen Hellenismus, sei es ist nicht verwunderlich, dass die Botschaften Hölderlins vom Dritten Reich beansprucht wurden. Denn: „Vom Hellenischen, das sich Hyperion erträumte, bis zum großen Germanien, wo der Mensch in perfekter Harmonie mit der Landschaft, dem Volk und Gott lebt, ist nur ein Schritt.“ (S. 60)
Und was sei von dieser Zwillings-Romantik zu halten? Bruns Schlussfolgerungen landen in einem doppelseitig besetzten Konstrukt, das idyllisch und zugleich diabolisch ist, dem SS-Mann, der nur wenige Schritte von den Verbrennungsöfen entfernt sich an „göttlichen Harmonien“, an der Sprache Hölderlins und an Reproduktionen der Gemälde von Caspar David Friedrich erfreut. Es ist ein Widerspruch in sich, den der Autor mit dem hilflosen Hinweis auf das komplexe Wesen des Menschen zu klären versucht und keine Antwort findet.
Ungeachtet solcher nicht überraschenden Teil-Erkenntnisse erweist sich die Lektüre aufgrund ihrer unterschiedlichen Erzählweisen in vieler Hinsicht als impulsgebend. Es ist sind die intensiven, liebevollen Bekenntnisse des Erzählers zu seiner Mutter, die nach ihrem furchtbaren Auschwitz-Aufenthalt zu einem Leben zurückfindet, in dem ihr Sohn versucht, den Ursachen ihrer schweren Depressionen nachzugehen. Dass er auf diesem Weg erst nach dem Tod seiner Mutter seine eingehende Liebe zum deutschen Bildungsroman nicht nur entdeckt, sondern sie auch in einer eigenwilligen doppelten Bild-Wort-Synthese benutzt, um die Ursachen der verhängnisvollen Synthese von germanischem Hellenismus und deutschem rassistischem Vernichtungswahn aufzudecken, ist ein gewagtes Konstrukt. Doch solche Nachfragen treten in den Hintergrund angesichts eines Romans, in dem die Auswirkungen des Jahrtausend-Verbrechens an dem Schicksal einer Jüdin französischen Ursprungs rekonstruiert werden. Dieses schwierige Unternehmen gelingt Frederic Brun, indem er seinen Plot in kleine Erzählpassagen aufteilt, die fotografischen Abbildungen zwischen die einzelnen Abschnitte platziert und seine wertende Stimme vorsichtig in den Handlungsablauf einbringt. Auf diese Weise leistet er einen eigenwilligen Beitrag zur französischen Shoa-Literatur, der zurecht honoriert wurde.
***