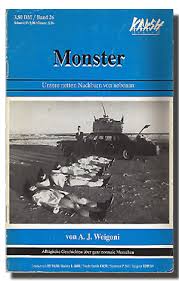Katerstimmung. Trübe Lider. Tränensäcke. Das eingefallene Gesicht im Spiegel zeigt sein Feindbild. Je genauer er hinsieht, desto grösser werden die Details und die Konturen seines Ichs verschwinden. Jeden Morgen stellt er dem Mann im Spiegel die gleiche Frage. Schneidet sich beim Rasieren am rechten Nasenflügel. Dunkelrotes Blut rinselt durch weissen Rasierschaum. Tropft in das Becken. Verwässert. Läuft in den Siphon. Er schabt sein Gesicht frei. Nackt erkennt er, was von ihm übrig geblieben ist. Das Rasierwasser verhüllt es kaum.
Der Nachrichtensprecher im Frühstücksfernsehen verkündet lächelnd das concerto chaotico. Hinter der Maske seines Lächelns lauert der Pesthauch des inneren Zerfalls. Der Toaster kokelt das Brot an. Das Spiegelei zerbrät. Der pechschwarze Kaffee schmeckt bitter. Die Vitamintablette pusht nicht.
Verkehrsinsel. An einer Ampel stehen Kinder in Startposition. Autofahrer sehen gelb. Die Kinder starten zum Sprint. Hoppeln los, als seien sie Spielzeughasen. Das Jüngste ist zu langsam. Es hat die Mutprobe nicht bestanden.
»Sie nutzen nur 80 % der Ihnen zur Verfügung stehenden Kapazitäten. Wollen Sie einen Persönlichkeitstest machen?«, beklagt der Vertreter einer Sekte mit reisserischer Stimme den Verlust tradierter Identitäten.
»Tut mir leid, bin schon dreimal durchgefallen«, lächelt der Kuttenträger den Lebenszeitvampir nieder und verzichtet auf modulare Dienstleistungen. Der Rocker ist ein Phänotyp vergangener Juvenilität. Was einst rebellische Wildheit verkörperte, ist Alterungsprozessen unterworfen. Die Formation rebellischer Unangepasstheit ruft heutigentags den Eindruck von Bedürftigkeit wach.
Auf dem Vorplatz des U–Bahnhofs proben Skateboardfahrer für den Winterurlaub. Ihr Ziel ist der Umweg. Die Slalomstangen sind beweglich. Eine alte Frau zieht ihren Einkaufswagen unglücklich zur Seite. Das Kamikaze–Kid kommt mit einer Platzwunde davon. Es muss heute nicht zur Schule.
Ein Skin wird erwischt, wie er einer türkischen Hausfrau im Supermarkt Schokolade in die Einkaufstasche steckt, um nachher die Belohnung für Ladendiebstahl zu kassieren. Der wahre Taschendieb flüchtet mit seiner Beute über die Gleise. Er achtet nicht auf die entgegenkommende Bahn.
Morgens im öffentlichen Nahverkehr sieht man die Wurmhaftigkeit des Menschen, dessen Unfähigkeit zu Glück, erlösendem Wandel der Optionen, wachsendem Kunstverstehen. Er sitzt über diese Menschen nicht zu Gericht; verzeichnet beiläufig ihr Leid. Menschlichkeit erscheint als die Schwäche des Anderen. Er registriert mit analytischem Verstand, was geschaffen wurde und wie es gemacht ist. Ihre Hautausdünstungen verraten die schlechtverdaute Mahlzeit vom Vorabend. Die Mitreisenden greifen nach den Haltegriffen und lüften ihre Achseln. Er riecht nach Ohrenschmalz, Haarfett und Gel. Der Frühverkehr stockt. Die Straba steckt im Verkehrsstau. Er steigt um. Hält den Anschluss.
»Eh, Alterchen, Bock auf ’ne kurze Nummer auf’m Klo?«, flüstert ihm eine Hure in der voll besetzten S–Bahn ins Ohr. Er wendet sich ihr zu. Sie ist jung. Etwa im Alter seiner Tochter. Hat während der Nachtschicht nicht genug verdient. Er greift unauffällig unter ihren Minirock. Tastet über ihren Oberschenkel. Schiebt einen Geldschein unter ihren Slip. Sie geht auf die Toilette. Verriegelt die Tür nicht. Er steigt eine Haltestelle zu früh aus und sucht vergeblich nach Blickachsen.
Vitrine des Verfalls. Die Arbeitersiedlung wird nicht saniert, da es mehr Profit bringt, sie als Filmkulisse zu vermieten. Die Ruinenbewohner müssen nicht mehr ausgebeutet werden, sie werden nicht mehr gebraucht. Vorschriften sind dazu da, die Menschen zu demütigen, so kann man einander Gewalt antun, ohne sich die Finger schmutzig zu machen. Gewalt ist nicht in den Stahl einer Waffe eingegossen, sie ist ein Verhältnis der Menschen untereinander. Das, was man strukturelle Gewalt nennt, wird immer von Menschen an Menschen ausgeübt.
Eckensteher greifen zu Tricks, um beim Verteilungskampf um Waren und Geld nicht aussen vor zu bleiben. Pitbullhalter sammeln Elektro–Schrott, zünden ihn an und verkaufen das gewonnene Altmetall, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Antriebsschwäche führt zu einer inneren Leere, die nicht mehr gefüllt werden kann. Äusseres Elend schlägt in Selbstverwahrlosung um, aus Missachtung wird Selbstverachtung. Das Warten in den Fluren der Ämter, die wachsende Wut und Hilflosigkeit, der aufkommende Selbsthass, weil man nichts zustande bringt und aus dem System ausgeschlossen bleibt. Das Leben hat diese Menschen befallen wie eine bösartige Krankheit. Sie trinken, bis sie müde genug zum Schlafen sind. Ihr aktives Sterben ist die radikalste Form ihres Protestes.
Dieser Stadtteil wird von schönen Menschen regiert, die von riesigen Plakaten hinablächeln. Sie tragen Armani–Anzüge und Gucci–Kostüme. Sind jung, sexy und offenbar reich. Wirken bestimmt, geordnet, bleiben cool und surfen elegant auf der Geldwelle. Die Drogenhändler auf dieser Strasse sind Kapitalisten, die Chancen erkennen, Unternehmergeist zeigen, ein investitionsfreundliches Klima schaffen und zwischen legaler Ökonomie und Schattenwirtschaft unterscheiden.
Rapper, Schlepper, Bauernfänger. Das Problem besteht darin, Städte zu schaffen, die sich anpassen an die neue Gesellschaft und an die sich abzeichnenden neuen Menschen. Realität ist eine Peripherie, deren Randständigkeit um so trostloser erscheint, da es ein Zentrum nicht gibt. Im Gewirr des neuen Verkehrsleitsystems ist alles dem Verfall preisgegeben. Der Strassenbelag wird aufgerissen. Malocher erneuern die marode Kanalisation. Presslufthämmer lassen ein Crescendo erklingen. Der Vorarbeiter pfeift den Gassenhauer über die Berliner Luft.
Aushäusiger Hospitalismus. Obdachlose unterhalten sich mit rudernden Armbewegungen. Wollen das Leben nicht, aber es muss gelebt werden. Es sind dauerhaft überflüssige Menschen, die vom Wirtschaftsprozess ausgespieen wurden und am Rande des Vergessens liegen. Sie bilden in einer Gesellschaft der Arbeitsreligion keine Reservearmeen für kommende Produktionsfeldzüge. Ihre Arbeitskraft zu nutzen, erscheint auf absehbare Zeit niemandem mehr rentabel, der ökonomische Effekt, den sie als Konsumenten machen, bleibt marginal.
Er weicht diesen Typen aus, tritt auf den Hut eines Bettlers. Das Elend bekommt ein Gesicht. Es schaut einen mit leeren Augen und versteinerter Miene an. Das Risikoerleben hat einen Eigenwert bekommen. Der Systemwechsel hat Neureiche produziert, die nicht über die Quelle ihres Reichtums Auskunft geben. Der Beinamputierte hat keine Kraft mehr, sich zu wehren. Er kümmert sich darum, den Tag zu überstehen. Wer nicht gewinnt, wird nachdenklich. Wer dauernd verliert, ärgert sich. Flehend hält ihm der sozial Entkoppelte seinen Hut hin. Entschuldigend lässt er einen Schein hineingleiten. „Eigentum verpflichtet“, heisst es im Grundgesetz. Reichtum eigentlich noch mehr. Die wahre Revolution wäre Steuerehrlichkeit. Devot bedankt sich der Berber und wünscht einen schönen Tag.
»Guten Morgen, mein Engel.«
»Tach Chef. Schlecht geschlafen, woll?!«
»Sag mir ’n triftigen Grund dafür, warum und vor allem, wofür wir noch leben.«
»Denk‘ darüber nach, wenn du die Midlife–Crisis überwunden hast«, schnoddert sie dahin. Verpeiltes Hippstertum. Sharon ist eine aufgetriedelte Hippieschnecke voller Wortgewölk und Lifestyleschmus. Sie seufzt mitleidig, setzt den Kopfhörer auf und tippt ein Diktat ab. Frauen müssen in dieser Firma tagtäglich bemüht sein, die Differenz durch Überanpassung zu negieren. Deshalb reagiert sie gereizt, wenn man sie auf ihr besonderes weibliches Berufsvermögen anspricht. Ihm reicht es, dass die Daktylografin seine Termine koordiniert und das Softwarepaket beherrscht. Bei seinen anderen Mitarbeitern verlangt er analytisches Denken und legt Wert auf Softskills. Wichtige Aspekte der Persönlichkeitskompetenz sind für ihn: Veränderungsbereitschaft, Belastbarkeit, Einstellung zur Arbeit, Kritikfähigkeit und die Bereitschaft zur Selbstreflexion. Denkapparate funktionieren auf den Schienen verschiedener Parallelrealitäten, zwischen denen sie hin– und herschalten können. Keine ihrer Realitäten ist prinzipiell realer oder auch irrealer als eine andere.
Er greift die Post. Geht in sein Büro. Sortiert auf dem Weg die lästigen Briefe aus. Entsorgt sie in die Rundablage. Setzt sich an den Arbeitsplatz. Schaltet den Rechner ein. Schlüpft in seine Hausschuhe. Zündet sich seine erste Arbeitszigarette an. Sichtet seine eMails und das FAX–Gerät. Auf dem Bildschirm des Computers leuchten nur noch Fragmente der Programme auf. Ein tückischer Virus hat die Festplatte weggeätzt. Wie bei jedem Aufsteiger, der sich durch die sozialen Schichten gefräst hat, ist auch sein grösster Albtraum, dass ihn seine Vergangenheit einholt.
Seine Forschungsergebnisse der letzten Monate sind abgestürzt. Er lehnt sich zurück, greift nach seiner Büroflasche, giesst sich einen Drink ein und spült den schalen Geschmack aus dem Mund. Von innerer Unruhe getrieben, stellt er sich ans Fenster, um die Wolken beim Vorüberziehen zu betrachten. Sie skizzieren keinen Entwurf, transportieren keine Bedeutung, verkünden keine Botschaft, bestehen aus kleinsten Wassertröpfchen oder Eiskristallen. Die Ikonen des Augenblicks erscheinen ihm als Spielbälle der Elemente, vom Wind getrieben, beim ersten Anstieg vorm Gebirge beginnen sie sich zu entleeren und damit aufzulösen. Verführerisches Spiel der Schatten, das Öffnen der Wolkendecken erscheint ihm als Vorhang für ein Stück. Er will die Wolken mit einer Poesie des ersten Blicks einfrieren und die Welt noch einmal neu entstehen lassen und versucht die Wirklichkeit da zu verstehen, wo sie nichts preisgeben möchte.
Im Büro auf dem Lichthof gegenüber liegt die Chefsekretärin mit gespreizten Beinen auf dem Schreibtisch. Über sie gebeugt sein Vorgesetzter, der in der Eile vergessen hat, die Vorhänge zuzuziehen und sie wie ein Presslufthammer pudert. „Das Lächerliche ist immer auch traurig, das Hässlichste und Albernste kann einen Wimpernschlag lang das Allerschönste sein. Man darf es nur nicht festhalten wollen“, denkt Zelmer, lächelt diabolisch, greift zu seinem Feldtelefon und ruft bei seinem Chef an. Dieser nimmt nach einer Weile schnaufend ab.
»Gott beobachtet dich!«, flüstert Heiner Zelmer sinister. Sein Vorgesetzter greift sich an die Brust und bricht zusammen. Zelmer giesst sich einen weiteren Drink ein, greift mit der anderen Hand zum Haustelefon und ruft den Rettungsdienst an.
***
Monster, Short-Stories von A.J. Weigoni. Krash-Verlag 1990
In der Reihe Gossenhefte zeigt sich, was passiert, wenn sich literarischer Bodensatz und die Reflexionsmöglichkeiten von populärkulturellen Tugenden nahe genug kommen. Der Essay Perlen des Trash stellt diese Reihe ausführlich vor. Dem Begriff Trash haftet der Hauch der Verruchtheit und des Nonkonformismus an. In Musik, Kunst oder Film gilt Trash als Bewegung, die im Klandestinen stattfindet und an der nur ein exklusiver Kreis nonkonformistischer Aussenseiter partizipiert. Dieser angeschmutzte Realismus entzieht sich der Rezeption in einer öffentlichen Institution. Daher sei sei Enno Stahls fulminantes Zeitdokument Deutscher Trash ebenso eindrücklich empfohlen wie Heiner Links Vorwort zum Band Trash-Piloten.
→ Die Monster Short-Stories waren die Vorstufe zu Zombies, Erzählungen von A.J. Weigoni, Edition Das Labor 2010
→ KUNO übernimmt zu Zombies einen Artikel von Kultura-extra aus Neue Rheinische Zeitung und fixpoetry. Enrik Lauer stellt den Band unter Kanonverdacht. Betty Davis sieht darin die Gegenwartslage der Literatur. Constanze Schmidt erkennt literarische Polaroids. Holger Benkel beobachtet Kleine Dämonen auf Tour. Ein Essay über Unlust am Leben, Angst vor’m Tod. Für Jesko Hagen bleiben die Untoten lebendig.